Im 7. Sinfoniekonzert des Staatstheaters Darmstadt setzen sich klassische und zeitgenössische Komponisten mit dem Wesen des Krieges auseinander.
Am 8. Mai jährte sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum siebzigsten Mal, und das bot sich als Anlass für eine entsprechende Programmgestaltung des zu diesem Termin anstehenden siebenten Sinfoniekonzert des Staatstheaters Darmstadt an. Generalmusikdirektor Will Humburg entwickelte zu diesem „Motto“ ein Programm, das einen großen Bogen vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart spannte. Dabei sind Komponisten und Stoff kunstvoll verwoben. Der Zeitgenosse Siegfried Matthus (Jahrgang 1934) hat eine Chronik von Rainer Maria Rilke über den Tod eines noch jungen Vorfahren in den Türkenkriegen des 17. Jahrhundert vertont, dazu erklingen wie eine parodistische Begleitung fünf Märsche von Mauricio Kagel (1931-2008). Als Pendant dazu Beethovens „Eroica“, eine geschichtlich aufgeladene Feier der Revolution und der Aufklärung sowie der Trauer über die desillusionierenden Realitäten des frühen 19. Jahrhundert. Hier sind Stoff und Komponist zeitgeschichtlich deckungsgleich.
Rilkes Erzählung über „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ beschreibt den Zug des erst Achtzehnjährigen nach Ungarn gegen die Türken, wobei er als Cornet die Fahne tragen darf. Er sieht das Treiben des Krieges und das Leiden der Bevölkerung, lernt das Heimweh und die Todesfurcht der Soldaten kennen, erlebt eine letzte Liebesnacht in einem Schloss nahe der Front, ehe er, nur mit der Fahne bewaffntet, aus dem brennenden Schloss gegen den angreifenden Feind anreitet und dort den Säbelhieben erliegt. Siegfried Matthus hat diese Erzählung in programmatische Musik umgesetzt, die dem Seelenzustand des Cornets und den Handlungselementen musikalisches Kolorit verleiht. Man kann diese Musik durchaus als szenische Oper verstehen, und Matthus hat seine Musik wohl auch so verstanden. In Darmstadt trägt jedoch der Schauspieler Christian Klischat Rilkes Text in einer leicht gekürzten Form zu Matthus´ Musik vor, so dass man von einer konzertanten Sprechoper reden könnte.
Das Ganze beginnt mit einem „dies irae“, vorgetragen vom Chor des Staatstheaters und begleitet von Paukenwirbeln. Anschließend folgen fünf der „10 Märsche um den Sieg zu verfehlen“, die Mauricio Kagel als Parodie der Militärmusik und gleichzeitig als satirischen Kommentar zum Militarismus zu einem Zeitpunkt geschrieben hat, als noch der „Kalte Krieg“ herrschte (1978/79). Diese Märsche kommen mit viel Blechinstrumenten daher, konterkariert von den weicheren Klarinetten und Flöten, und die Raffinesse steckt in der schrägen Harmonik und versetzten Rhythmen, mit denen Kagel die hinter der herkömmlichen Militärmusik stehende Ideologie von Befehl und Gehorsam bis zum Tod karikiert. Die grellen, die Grenze zur Dissonanz des Öfteren überschreitenden Klangfarben und die ins Lächerliche gezogene „Schmissigkeit“ der Musik stehen für den Wahnsinn des Krieges und vor allem der Beschönigung in den Militärmärschen aller Epochen.
Matthus´Musik überrascht dagegen mit einer erstaunlichen Tonalität, die zwar moderne harmonische Elemente aufnimmt, aber immer wieder auch lyrische Elemente oder emotionale Aufwallungen einflicht, die Ähnlichkeiten vor allem mit spätromantischer Musik – etwa Brahms – aufweisen. Die ganze tragische Dramatik der Geschichte des blutjungen Cornets Rilke wird in der Musik lebendig, und zusammen mit dem Text des späten Nachfahren des Cornets entführt die Musik den Zuhörer tatsächlich in die gefahrvolle Welt des 17. Jahrhundert und in die Seele eines Achtzehnjährigen, der gerne zu Hause bei einem Mädchen wäre, der seine Mutter liebt, der eine im wahrsten Sinne des Wortes wunderbare Liebesnacht erlebt und der dennoch seine soldatische Pflicht als eine existenzielle Ehre bis hin zum „Heldentod“ begreift.
Nach den leise verklingenden Worten über die Nachricht an die Mutter des Toten erklingt dann noch einmal der „dies irae“ wie eine Mahnung an alle Generationen, so etwas nicht wieder zuzulassen. „Doch die Verhältnisse – sie sind nicht so“ – siehe Ukraine.
Man hat Beethovens 3. Sinfonie, die „Eroica“, oft mit Beethovens Begeisterung für den Erneuerer Napoleon und die Enttäuschung über dessen Schwenk vom Revolutionär zum autoritären Monarchen in Verbindung gebracht. Beethovens Neigung zu dem Franzosen ist wohl belegt, und auch die Entstehungszeit der Sinfonie spricht dafür. So lässt sich der erste Satz durchaus als eine Huldigung an eine revolutionäre Aufklärung verstehen. Die Tonart Es-Dur steht für Aufbruch und Klarheit, und das wiederkehrende einfache Motiv steht ebenfalls für eine Art Aufbruch zu neuen Ufern. Den zweiten Satz haben manche Auguren als Zeichen der Enttäuschung über die Kaiserkrönung verstanden. Dieser Interpretation widerspricht zwar die zeitliche Abfolge von Uraufführung (Mitte 1804) und Krönungsfeierlichkeit (Dezember 1804), aber man kann annehmen, dass diese Krönung lange Schatten bis in die Entstehungszeit der Sinfonie vorausgeworfen hatte. Dieser zweite Satz bringt nämlich eine Trauer weit über den Tod eines Mäzens – wie auch kolportiert wurde – hinaus zum Ausdruck. Hier herrschen die schwärzesten Gedanken der existenziellen Enttäuschung angesichts einer zerstörten Hoffnung. Nicht umsonst trägt dieser Satz die Bezeichnung „Trauermarsch“. Der dritte Satz schüttelt die Trauer des zweiten dann wieder ab, frei nach dem Motto „es muss doch weitergehen“, so wie die Menschen nach Kriegen wieder anpacken, die Trümmer wegräumen und neu beginnen. Verhaltener Optimismus prägt dieses Scherzo. Der vierte Satz schließlich nimmt ein Variationenthema auf, dass Beethoven bereits früher für Klavier solo komponiert hatte. Auf geradezu heitere Weise lässt Beethoven das Thema durch alle Instrumente, Abänderungen und Klangfarben laufen, so als wollte er sagen: „nach Revolution, Rückschlag und Enttäuschung nahen doch Friede und Versöhnung“. Hiermit näherte er sich unwissentlich dem späteren Geschichtsphilosophen Karl Marx an, der die Geschichte in eben genau diese Abfolge unterteilte – und irrte.
So kann man auch Beethovens „Eroica“ als Paraphrase auf Krieg, Revolution und (falsche?) Utopien sehen, wobei hier Beethovens unverkennbarer aufklärerischer und optimistischer Impetus im Vordergrund steht. Will Humburg näherte sich diesem Werk mit einer gewissen Distanz und achtete von vornherein auf eine schlanke Interpretation. Das merkte man bereits an der deutlichen Ausdünnung des Orchesters. Der transparente, federnd leichte Klang ließ gar nicht erst kriegerisches oder revolutionäres Pathos aufkommen. Die Gefahr Beethovenscher Bombastik war so von vornherein gebannt. Schon die ersten beiden Schläge kamen nicht als dröhnende Trommeln der Revolution sondern als pointierte Akzente daher, von denen aus sich dann der Fluss der Motive des ersten Satzes entwickelte. Auf den zweiten Satz legte Humburg besonderes Gewicht und dabei gelang es ihm, den schmalen Grat zwischen Spannungslosigkeit und pathetischem Lamento einzuhalten. Der ganze Schmerz einer enttäuschten Seele fand sich in diesem Satz wieder, und keinen Augenblick geriet diese Klage zur reinen Larmoyanz. Dem Scherzo verlieh Humburg einen akzentuierten Charakter, der durchgängig wie ein „Dennoch“ klang, und im vierten Satz ließ er dann der Musikalität freien Lauf, ohne jedoch in nichtssagende Heiterkeit zu verfallen.
Die „Eroica“ war der krönende Abschluss eines Konzerts, das dem Jubiläum des Kriegsende ein würdiges Denkmal setzte und mit seiner Bandbreite der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten beeindruckte. Das Publikum empfand die Besonderheit dieses Konzerts und seines Abschlusses offensichtlich genau auf diese Weise und spendete begeisterten, lang anhaltenden Beifall.
Frank Raudszus


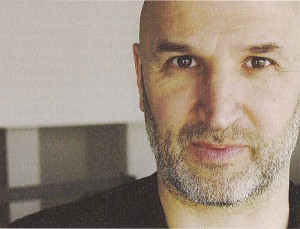

No comments yet.