Das Licht ist für den Menschen eine der selbstverständlichsten und notwendigsten Grundbedingungen des Lebens. Diese Selbstverständlichkeit kostete das Licht sogar einen Platz unter den physikalischen Grundelementen der Antike: Erde, Wasser, Feuer und Luft.
Isaac Newton hat im 17. Jahrhundert die Grundlage einer Physik geschaffen, die die Erscheinungen der Natur systematisch auf der Basis der menschlichen Anschauung erforscht. Das ging auch lange gut: man entdeckte die elektromagnetischen Wellen und stellte fest, dass das Licht unter diese Kategorie fällt und sich in seinen Auswirkungen letztlich ähnlich berechnen lässt wie längere Wellen – etwa Radiowellen – oder kürzere – etwa Röntgenstrahlen. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war die Welt in Ordnung, eben weil man (fast) alles mit den entsprechenden mathematischen Methoden widerspruchsfrei berechnen konnte.
Dann jedoch kamen Max Planck und Albert Einstein und störten die behagliche wissenschaftliche Ruhe. Ersterer stellte fest, dass gewisse subatomare Vorgänge nur in diskreten Stufen – sogenannte „Quanten“ -abliefen, und letzterer zog unter anderem aus Plancks Erkenntnissen den Schluss, dass auch das Licht aus diskreten Elementen bestehen müsse, eben den von ihm so genannten Lichtquanten. Keiner von beiden konnte jedoch etwas über die konkrete Beschaffenheit dieser Quanten sagen, und die in sich widersprüchliche Tatsache, dass man die Quanten als „masselose Teilchen“ betrachtete, lässt die Ratlosigkeit der Wissenschaft deutlich zutage treten.
Anfang der zwanziger Jahre hatten sich in Europa zwei Lager gebildet: die der Wellen-Anhänger und die der Quanten-Freunde. Die Tatsache, dass es für jede der beiden Theorien stichhaltige empirische Beweise gab, verschärfte die Diskussion, und so mancher Wissenschaftler – Einstein eingeschlossen – suchte nicht die Widerlegung der Gegenseite, sondern deren Integration in eine übergreifende Theorie. Daran arbeitet die Wissenschaft noch heute.
Thomas de Padova beschreibt die zehn Jahre zwischen 1919 und 1929 aus der Perspektive dieser Situation. Dabei steht anfangs Werner Heisenberg im Vordergrund, der bereits im Alter von 21 Jahren eine bahnbrechende Doktorarbeit zu diesem Thema verfasst, aber fast durch die Prüfung fällt, da er andere, prüfungsrelevante Aspekte der klassischen Physik rundweg ignoriert hat. Doch seine „Matrizenkalkulation“ löst unerwarteterweise das Beschreibungsproblem der Quantenwelt und katapultiert Heisenberg in die oberste Ebene der Physik. Ab jetzt kommuniziert er ausgiebig mit Leuten wie Niels Bohr in Kopenhagen und Max Born in Göttingen, die auch weitere renommierte Physiker aus dem In- und Ausland anziehen. Max Planck, selbst schon international hochgelobter Experte, verfolgt die Diskussion intensiv, obwohl er selbst noch Vertreter der klassischen Physik ist und „Unbestimmtheiten“ nicht akzeptieren kann. Auch Einstein beteiligt sich an den Diskussionen, mal mehr, mal minder engagiert, legt sich jedoch nie fest. Er gehört zu denen, die eine „Theorie von allem“ suchen, wird sie aber bis an sein Lebensende nicht finden.
Der Autor verdeutlicht das Problem der konkurrierenden Theorien anschaulich, ohne dazu mathematische Formeln zu nutzen. Selbst Schrödingers „Wellengleichung“ erwähnt er, verzichtet jedoch auf ihre Darstellung. Offensichtlich will er ein breiteres Publikum ansprechen und nicht mit unverständlichen Formeln verschrecken. Dass ein physikalisches Phänomen aus klassischer Sicht nicht gleichzeitig Welle und Teilchen sein kann, veranschaulicht er jedoch recht gut. Dabei geht er jedoch nicht auf die Frage ein, warum sich Wellen im Vakuum ausbreiten. Die Physik weiß, dass sie es tun, kann jedoch nicht erklären, warum. Teilchen dagegen können nach physikalischem Verständnis auch durch ein Vakuum fliegen.
Das Buch nimmt nur langsam Fahrt auf, weil Padova erst die Personen sowie die Themenstellung vorstellen muss. Mit den Jahren jedoch festigen sich sowohl die Anschauungen als auch die Lager, und die Erkenntnisse oder Hypothesen nehmen zu. Neue Personen wie Wolfgang Pauli stoßen hinzu und bereichern die Diskussionen, und die Handlung nimmt teilweise fast kriminalistische Züge an, wenn sich die Kontrahenten gegenseitig ihre Argumente vortragen und die gegnerischen zerpflücken. Bewundernswert ist dabei, dass all die Diskussionen und ja: Streitereien nie – oder nur selten – ins Persönliche abgleiten. Man kann sich stundenlang streiten und doch dabei durch Dänemark wandern oder beim Essen sitzen. Diese Physikergemeinde wirkt streckenweise wie eine Großfamilie, die sich zwar gern streitet, aber immer wieder zusammenfindet.
Im Jahr 2927 treffen sich alle maßgeblichen Physiker zur berühmten Solvay-Konferenz in Brüssel, bei der zum ersten Mal nach dem Weltkrieg auch die Deutschen wieder vollwertige Teilnehmer sind. Auf höchstem Niveau diskutieren die Teilnehmer den unlösbar scheinenden Doppelcharakter der subatomaren Teilchen und gehen dabei das gesamte Panorama der teilchenartigen Wellen bzw. wellenartigen Teilchen durch, ohne zu einem allseits befriedigenden Ergebnis zu kommen. Das mag die Teilnehmer frustriert haben, doch für die heutigen Leser ist es der Beweis, dass der menschliche Geist sich bis an die Grenzen der eigenen Wahrnehmung vorgearbeitet hat. Und das dürfte wohl ein größeres Kompliment an die Wissenschaft sein als ein Kompromiss um der Einigkeit willen. Und dem Autor gelingt es dabei, diesen Kongress als den Höhepunkt des Buches zu inszenieren, ganz wie den „Showdown“ am Ende eines Kriminalromans. Man spürt hier den Willen aller Beteiligten zur Erkenntnis und die leidenschaftlilche Ablehnung unvollständiger Lösungen.
Am Ende des Jahrzehnt steigt schon der Nationalsozialismus am Horizont hoch, und Einstein trägt sich mit ersten Auswanderungsgedanken. Der Autor beleuchtet noch ein wenig die späteren Lebensläufe der wichtigsten Protagonisten und überlässt dann das Quantenthema heutigen und späteren Generationen.
Das Buch ist im Hanser-Verlag erschienen, umfasst 430 Seiten und kostet 28 Euro.
Frank Raudszus

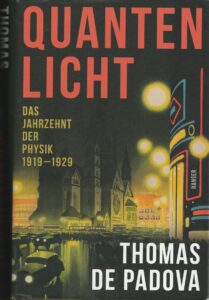
No comments yet.