Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas ist allein schon durch sein Alter von mittlerweile 95 Jahren zu einer Ikone des deutschen Nachkriegsgeistes geronnen, und sein Name wird in eingeweihten Kreisen geradezu ehrfürchtig ausgesprochen. Explizite Gegnerschaft oder gar Spott – wie im Falle Precht zu Recht – findet man selbst im satirischen Umfeld nicht. Diese Sonderstellung in der intellektuellen Oberschicht Deutschlands reizt natürlich dazu, ihr auf den Grund zu gehen.
Philipp Felsch, von dem wir bereits das Buch „Wie Nietzsche aus der Kälte kam“ besprochen haben, ist selber Professor der Philosophie an der Humbold-Universität und hat sich dem Thema Habermas auf seine ganz eigene Art gestellt. Das vorliegende Buch stellt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Werkanalyse, ist aber auch keine menschelnde Biographie, sondern bewegt sich als Gratwanderung zwischen wissenschaftlichem Kommentar und gesellschaftlicher Verortung des Portraitierten. Der Untertitel „Habermas und wir“ bringt dies programmatisch zum Ausdruck.
Die Rahmenhandlung dieses Buches, zwei Interviews mit Habermas in dessen Starnberger Heim, wirkt in dieser Hinsicht geradezu paradigmatisch: ausgehend von diesen persönlichen Gesprächen entwickelt Felsch ein intellektuelles Lebensbild seines Gegenübers.
Habermas, Jahrgang 1929, war im Jahr 1945 zu jung, um in irgendeiner Weise für die zwölf Jahre davor haftbar gemacht werden zu können. Gleichzeitig gehört er zu einer Generation, die nach dem Krieg von Neuem anfangen und eine bessere Gesellschaft aufbauen konnte. Das hatte er mit alten Freunden wie Hans Magnus Enzensberger oder Martin Walser gemeinsam, mit denen er sich jedoch auch wegen politischer Ansichten durchaus zerstreiten konnte.
Felsch schafft das Kunststück, einen kurzen Abriss von Habermas´ Hauptwerken zu geben, ohne den Leser in intellektuelle Probleme zu stürzen. Freimütig bekennt er, sich selbst nur unter Qualen durch die so anspruchsvolle wie kryptische Sprache gekämpft zu haben, und vermittelt dennoch verständlich, worum es Habermas in seinem philosophischen Werk ging. Vor allem die „Theorie des kommunikativen Handelns“ setzt darauf, dass eine lebendige und funktionierende Gesellschaft allein aufgrund einer „idealen Sprechsituation“ mit dem rein rationalen Austausch von Argumenten möglich sei. Das während der 70er Jahre entstandene Buch, die 68er Studentenrevolten im Rücken, vermittelte noch den Eindruck einer konkret umsetzbaren Utopie, doch die Reaktion der intellektuellen Öffentlichkeit veranlassten den Autor später, nur noch von einem normativen Ziel auszugehen, ohne das man keine Theorie entwickeln könne.
Auch Habermas´ anderen Werke, so „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ und „Erkenntnis und Interesse“ werden kurz angerissen, jedoch nur im jeweiligen biographischen Umfeld und ohne detaillierte inhaltliche Ausführungen. Dennoch runden auch diese kurzen Erwähnungen das Bild des Philosophen Habermas ab.
Doch Felsch zeigt auch die widersprüchlichen – man möchte fast sagen „ambivalenten“ – Seiten von Jürgen Habermas. Als schreibender Philosoph bekannte er sich zu einer typisch bürgerlichen Existenz einschließlich Rückzug in den eigenen Raum zwecks konzentrierter Arbeit. Auch verzichten seine grundlegenden Arbeiten der Allgemeingültigkeit zuliebe auf konkrete Gegenwartsbezüge und abstrahieren laut Felsch die jeweiligen Erkenntnisse und Theorien fast bis hin zur Realitätsverweigerung. Das hat Habermas zwar oft den Vorwurf des realitätsfernen, ja: naiven Utopisten eingebracht, doch er bestand konsequent auf dem Primat des allgemeinen Denkens. Als Leser kennen wir die Gefahr, bei Vorliegen eines konkreten Beispiels dieses sofort als das Allgemeine zu betrachten – vor allem, wenn es mit unserer Sicht übereinstimmt. Die andere Seite von Habermas bezieht sich jedoch auf den konkreten politischen Einzelfall. Hier konnte er plötzlich zum engagierten und sogar polemischem Kommentator werden, der auch vor dem ultimativen Streit nicht Halt machte. Das beste Beispiel bietet hier der berühmte „Historikerstreit“, bei dem Habermas im Jahr 1986 den Historiker Ernst Nolte frontal wegen dessen apologetisch anmutender Interpretation von Hitlers Judenvernichtung attackierte und schließlich gegen alle Proteste vor allem der Kriegsgeneration die Deutungshoheit eroberte. Diese Seite schälte sich zwar erst in späteren Jahren heraus, dafür dann aber um so pointierter. Den Vorwurf getrennter Persönlichkeiten konterte Habermas überzeugend mit dem Hinweis auf die Bedeutung sowohl nüchterner wissenschaftlicher Grundlagenarbeit als auch engagierter Einmischung als Staatsbürger.
Zwar bewegte sich Habermas hier stets am Rande der Ambivalenz, aber Felsch erliegt nicht der Versuchung, als Autor professorale Kritik an ihm zu üben. Das überlässt er den Gegnern seines Protagonisten, die sich dessen bisweilen sogar persönlichen Angriffen gegenüber sahen. Als Nachkriegsmarxist und Mitglied der Frankfurter Schule der sechziger Jahre hatte Habermas ein klares (linkes) Weltbild entwickelt, in dem für ein nationales Selbstgefühl der Deutschen kein Platz (mehr) war. Als Freunde wie Martin Walser oder Karl Heinz Bohrer noch vor der Wende ein einiges Deutschland mit nationaler Identität beschworen, rief das Habermas´ schärfste Reaktionen hervor, die bis zur öffentlichen Bloßstellung des angeblich Irrenden im Partyumfeld reichten. Aus ähnlichen Gründen endeten so alte Freundschaften mit Martin Walser, Karl Heinz Bohrer und, etwas abgemildert, Hans Magnus Enzensberger. Felsch überlässt es dabei den Lesern, über Habermas´ Aussage nachzudenken, er sei beim Fall der Mauer „entsetzt“ gewesen, weil damit Wiedervereinigung und Nationalstolz plötzlich wieder im Mittelpunkt gestanden hätten. Die Leser können sich dann überlegen, was an der Selbstbefreiung von jahrzehntelanger Unterdrückung so entsetzlich ist.
Unterschwellig thematisiert Felsch auch die Tatsache, dass Habermas zu keiner Zeit selbst im Zentrum der Kritik stand. Die „Frankfurter Schule“ am Institut für Sozialforschung verließ er kurz nach Adornos Tod, um die von RAF-Konflikten zerrissenen Siebziger im geruhsamen Starnberg bei der Arbeit an seiner neuen Gesellschaftstheorie zu verbringen. Im Historikerstreit war er moralisch begünstigter Angreifer und geriet nie in die Defensive, und seine Ablehnung der Wiedervereinigung wurde auch nie öffentlich. Ob das auf intuitive Erkenntnis bezüglich des jeweiligen Zeitgeistes zurückzuführen ist oder auf glücklichem Zufall beruht, sei dahingestellt; auf jeden Fall festigte sich sein Status als „weiser Philosoph“ von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, ohne dass je der Lack abblätterte. Selbst jüngste, den Frieden fordernde Äußerungen zum Ukrainekrieg riefen kein großes Medienecho hervor. Vielleicht liegt das auch daran, dass man ihm in den Medien einen Altersbonus einräumt oder ihn schlicht nicht mehr kennt. Schließlich erodiert selbst bei den Medien das geisteswissenschaftliche Wissen.
Philipp Felsch jedenfalls vermittelt diese Kenntnis aus erster Hand, und das auf sachliche, doch durchaus engagierte Weise. Er will kein Denkmal errichten, aber auch keins vom Sockel stoßen, sondern beschreibt ein von selbst gewachsenes Denkmal in all seinen Facetten.
Das Buch ist im Propyläen-Verlag erschienen, umfasst einschließlich umfangreicher Anmerkungen 255 Seiten und kostet 24 Euro.
Frank Raudszus

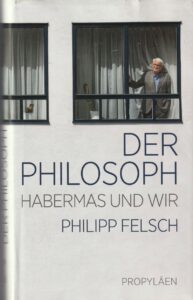
No comments yet.