Die autobiographischen Romane der dänischen Schriftstellerin Tove Ditlevsen (1917-1976) sind eine Wiederentdeckung des Aufbau Verlages. Tove Ditlevsen ist eine frühe Annie Ernaux des Nordens. Von der 1967 und 1971 auf Dänisch erschienenen autobiographischen „Kopenhagener Trilogie“ („Kindheit“ und „Jugend“ 1967, „Abhängigkeit“ 1971) wurde bisher nur der dritte Band 1980 unter dem Titel „Sucht“ bei Suhrkamp verlegt. Erst seit 2021 liegen alle drei Bände in der neuen Ausgabe des Aufbau Verlags vor.
Die „Kopenhagener Trilogie“ ist die fesselnde Erzählung einer Kindheit und Jugend unter schwierigsten sozialen Bedingungen in Kopenhagen, aus der sich das Mädchen Tove zur Schriftstellerin hocharbeiten kann. Das geschieht jedoch mit schweren psychischen Einbrüchen und einem immer wieder erschütterten Selbstbewusstsein, das bis zu einer schweren Drogenabhängigkeit führt, aus der sie sich schließlich befreien kann.
Dem Roman „Gesichter“ ist es ähnlich ergangen wie der Trilogie. Auf Dänisch erschien er 1968 unter dem Titel „Ansigterne“. Der dänische Titel erscheint noch nicht einmal in dem Wikipedia-Artikel zu Tove Ditlevsen, obwohl er bereits 1987 in der deutschen Übersetzung in der edition suhrkamp vorlag. Jetzt liegt „Gesichter“ in der neuen Übersetzung von Ursel Allenstein in der Ausgabe des Aufbau Verlags vor. Und welch ein Gewinn für die Leserschaft!
Tove Ditlevsen führt uns in diesem Roman in die Innenwelt der an einer schweren Psychose erkrankten Schriftstellerin Lise Mundus. Lise lebt mit ihrem Mann Gert und drei Kindern in offenbar wohlsituierten Verhältnissen in Kopenhagen. Seit sie den Kinderbuchpreis der dänischen Akademie gewonnen hat, kann man sich mit Gitte sogar eine Haushälterin und Kinderfrau leisten. Der plötzliche Ruhm, nachdem sie schon etliche, weniger beachtete Kinderbücher geschrieben hat, überfordert sie jedoch. Sie fühlt sich den Erwartungen nicht gewachsen, traut sich nicht, eigene Positionen zu beziehen, leiht sich die ihres Mannes, wie sie es auch schon zuvor bei ihrem Ex-Mann gemacht hat. Sogar die Dankesrede zur Preisverleihung lässt sie sich von ihrem Mann schreiben.
Zunehmend beäugt sie ihre unmittelbare Umwelt mit Misstrauen, fürchtet entlarvt zu werden als eine, die eigentlich nichts kann. Das führt zum Rückzug ins Haus, Rückzug aus aller Tätigkeit, die Familie wird von Gitte versorgt, auch sie selbst.
Der Beginn der Psychose deutet sich an, als sich in ihrem Bewusstsein die Gesichter der anderen verzerren. Die Gesichter scheinen sich loszulösen von den Personen. Gesichter werden zu Masken, zu etwas Austauschbarem, nicht mehr Fassbarem.
Tove Ditlevsen schildert Lises Weg aus diesem Anfangsstadium in die psychotische Wahrnehmung von Stimmen über das Rohrsystem der Wohnung. Sie fantasiert überall Verschwörung gegen ihre Person, verdächtigt ihren Mann der Beziehung zu Gitte wie auch zur eigenen Tochter. In ihrem kranken System scheinen alle Dinge zueinanderzupassen: Sie ist sicher, dass es um ihre Vernichtung geht, damit die anderen frei werden. Um sich zu retten, unternimmt sie einen Selbstmordversuch mit Schlaftabletten, den sie aber sogleich dem ihr aus einer vorangegangenen Behandlung bekannten Psychiater meldet, um der für sie bedrohlichen häuslichen Umgebung zu entrinnen in den schützenden Raum der Klinik.
Tatsächlich erwacht sie in der Psychiatrie mit Wahnvorstellungen und Stimmen. Die Gesichter von Patientinnen und Schwestern verwandeln sich zeitweise in Tiergesichter. Ihr völliger Realitätsverlust führt zu ständiger Angst vor Entlarvung. Sie hört die anderen ihr vorwerfen, dass sie alle ihre Sätze und Texte aus anderen zusammengeklaut habe, dass sie eigentlich gar keine Schriftstellerin mehr sei, weil sie seit zwei Jahren keine Zeile mehr geschrieben hat. Das aus der Kindheit stammende mangelnde Selbstbewusstsein bricht sich in den inneren Stimmen Bahn. Selbst der eigentlich vertraute Psychiater erscheint bedrohlich.
Tove Ditlevsen schildert die innere Verstörung einer Frau, die in einer von Männern beherrschten Welt versucht, ihren eigenen Weg zu gehen, die sich aber nur im Schreiben ganz bei sich selbst fühlt.
Der Erfolg der Frau aber bedroht den Ehepartner in seiner Männlichkeit, er könne doch nicht mit einem Buch ins Bett gehen. Der erste Mann gar verlässt sie, weil sie mit den Spuren von schwarzem Farbband an den Händen bei einem Empfang seine Diplomatenkarriere gefährdet habe.
Der eigene Mangel an Liebesfähigkeit treibt Lise um, nur in rituellen Floskeln kann sie noch mit ihrem Mann sprechen. Auf die Nachricht vom Selbstmord seiner Geliebten hat sie keine Worte, während er ihr Mitgefühl erwartet. Eine Zumutung und ein weiterer Hinweis auf das asymmetrische Verhältnis von Mann und Frau, auf eine Beziehung, in der der Mann die Oberhand behält und sich anmaßt, sie klein und dumm zu machen. Dagegen ist sie ohnmächtig.
Entsprechend der weiblichen Sozialisation sieht die die Fehler nur bei sich: Sie ist diejenige, die nicht lieben kann, die noch nicht einmal zur Nächstenliebe fähig ist, wie Gitte sie predigt.
Emanzipationsstreben ist auch im liberalen Norden im Nachkriegseuropa der 50er und 60er Jahre noch ein vermintes Feld. Lise scheitert daran.
Lises dreiwöchiger Aufenthalt in der Klinik gibt nicht nur einen Einblick in den Krankheitsverlauf, sondern auch in die fragwürdigen Methoden der damaligen Psychiatrie. Da werden Patientinnen ohne Weiteres fixiert, ins Badezimmer verfrachtet, wenn sie zu unruhig oder aggressiv sind. Die Einrichtung, die Schutz und Hilfe bieten sollte, scheint eher zur Verschlimmerung der psychotischen Ängste zu führen. Lise fühlt sich der Maschinerie der Klinik ausgeliefert, sie hat nichts, „keine Zigarette, kein Geld, keine Kleidung, keinen Lippenstift, keinen Kamm und keine Zahnbürste“. Sie ist ihrer Eigenständigkeit vollständig beraubt.
Auch die Figur des Psychiaters Jørgensen ist zwielichtig. Als Leserin ist man sich unsicher, ob er wirklich an den Nöten und damit auch an der Heilung der Patientin interessiert ist oder ob er nur an der eigenen Karriere arbeitet und einen schwierigen Fall schnell beenden will. In seiner Klinik werden die Patientinnen für „Fehlverhalten“ bestraft“, bei guter Anpassung belohnt. Von einer Therapie erfährt man nichts. Die Patientin wird entlassen, als der Psychiater meint, sie sei wieder in der Wirklichkeit angekommen. Tatsächlich hat sie eher gelernt, ihre Stimmen so zu verbergen, dass sie selbst sie als Warner versteht, ohne sie aber der Umwelt preiszugeben.
So ist auch die Rückkehr in die Familie mit vielen Fragezeichen versehen, denn das eigentliche Problem kann kein Psychiater lösen: den Verlust der Liebe.
Das Ende des Romans sieht versöhnlich aus, aber die Gefährdung eines Neuanfangs ist schon sichtbar: „Die Liebe hing zwischen ihnen wie ein gespanntes Stück Gaze. Lise wusste, dass sie nicht halten würde.“ Es bleibt die Ungewissheit, was „in dieser Welt wirklich ist und was nicht“. Damit wird Lise leben müssen, auch mit der Frage, ob die Wahrheit ergründbar ist und ob das immer nützlich ist. Fest steht am Ende nur ihr Entschluss: „‚Morgen‘, sagte sie, ‚werde ich wieder mit dem Schreiben anfangen‘.“
Tove Ditlevsen erzählt Lises Geschichte mit einer Eindringlichkeit, die uns unmittelbar in das Innere dieser zerstörten Seele führt. Ditlevsens Sprache ist geprägt von einer Bildlichkeit, die ihre Sensibilität für Lebensängste und Selbstzweifel mit einer Kraft ausdrückt, die der Leserin unter die Haut geht. Die Lektüre ist zeitweise schwer zu verkraften, gerade auch weil so wenig Hoffnung auf grundsätzliche Heilung zu bestehen scheint, denn die krankmachenden Verhältnisse werden sich nicht ändern.
In ihrem Nachwort stellt die Übersetzerin Ursel Allenstein die autobiographischen Bezüge zu Tove Ditlevsen her, die selbst mehrfach Patientin in psychiatrischen Kliniken war. Daher rührt wohl auch das Authentische dieser Innensicht einer Psychose.
„Gesichter“ ist eine unbedingt empfehlenswerte Lektüre. Die Leserinnen und Leser seien aber gewarnt, dass dieser Roman sie nicht so schnell loslassen wird.
Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, übersetzt von Ursel Allenstein. Er hat 160 Seiten und kostet 20 Euro.
Elke Trost

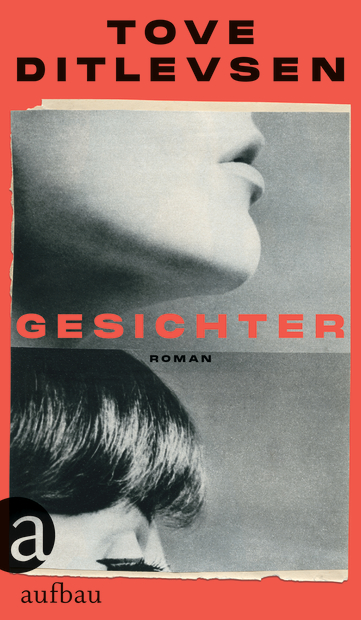
No comments yet.