„Worum geht es?“ Diese Frage ist das Leitmotiv, das sich durch Bov Bjergs neuen Roman „Serpentinen“ zieht. Der 2020 erschienene Roman stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020, und er wäre dieser Ehrung würdig gewesen.
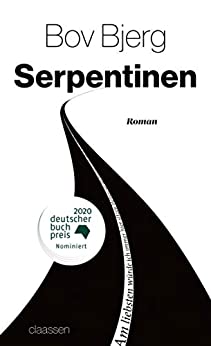
Worum geht es? Es geht um Vater-Sohn-Beziehungen, um Depression und Selbstzweifel, um Fremdheitsgefühle im gesellschaftlichen Miteinander. Der Erzähler hat sich mit seinem 7-jährigen Sohn von Berlin aus in sein Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb aufgemacht. In Serpentinen nähern sie sich diesem Ort an, der für den Vater zu einer Rückbesinnung auf die Familiengeschichte über mehrere Generationen führt.
Die Herkunft aus einer Arbeiterfamilie, der gewalttätige Vater und später auch der Stiefvater und die erlittenen Traumata verfolgen den Erzähler sein Leben lang.
Der soziale Aufstieg und der berufliche Erfolg bleiben nur äußerlich.
Er, Soziologe, Mitte 40, anerkannter Professor, der insbesondere für seine geschliffene Sprache und seine Exzellenz im Erstellen von Statistiken gerühmt wird, ist verheiratet mit M., einer erfolgreichen Juristin, die wie er den sozialen Aufstieg aus der Arbeiterklasse geschafft hat. Doch während sie sich im bürgerlichen Verhaltenscodex leichtfüßig bewegt, fühlt er sich in der Welt des lockeren Smalltalks und im akademischen Treiben fremd und unwohl, nicht dazugehörig.
Nur am Schreibtisch gehört er zu sich selbst. Im Übrigen will er gar nicht dazugehören, will seine Herkunftsklasse nicht verraten, lieber der Außenseiter bleiben, der auch mal ganz heftig seine Verachtung und seinem Ekel gegenüber dem Bildungsgetue der Kollegen kundtut.
Seine Familie ist seit Generationen geprägt durch die Selbstmorde der Väter: „Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt“. In den Familien wird das nach Möglichkeit verschwiegen. So muss man sich nicht mit den Ursachen für die Lebensmüdigkeit auseinandersetzen. Die Erzählungen in der Familie sind Legenden, „Famlienbla“, deren Wahrheitsgehalt der Nachgeborene nicht überprüfen kann.
Der verschlungene Weg mit dem kleinen Sohn in das Heimatdorf und auf den dortigen Friedhof wird für den Erzähler zu einem Weg zu seinen Wurzeln. Depression scheint in der männlichen Linie der Familie zu liegen, auch er selbst ist depressiv, hat Ängste, kann nicht ohne Alkohol, hat Beziehungsprobleme. Ist Selbstmord auch sein eigenes Schicksal, wird der noch kleine Sohn sich einreihen?
Der Weg hinauf ins Dorf ist die „Roadstory“, die er mit dem kleinen Sohn erlebt. Das Kind lebt ganz in der Gegenwart, holt den Erzähler immer wieder auf den Boden der Realität. Der Junge hat Wünsche, so möchte er die Versteinerungen im Museum ansehen, er kennt sich aus: „Ammoniten sind keine Schnecken“, der Vater vertröstet. Fossilien sind ihm zu symbolisch, obwohl er sich gegen diese platte Deutung wehrt. Dennoch weiß er, dass es darum geht, seine inneren Versteinerungen aufzulösen.
Und der Junge will klettern. Seine Seile wirft er um jeden Ast, den er erreichen kann – bis zu einem Unfall. Oder war es Absicht? Steckt auch in dem 7-Jährigen schon das Selbstmörder-Gen der Väter und Großväter?
Der Selbstmord des Vaters, als er noch ein kleiner Junge war, hat beim Erzähler eine große Lücke hinterlassen. Es gab für ihn keine Vater-Sohn-Beziehung, nur ganz frühe Erinnerungen an die Gewalttätigkeit des Vaters und an einen einzigen Annäherungsversuch. Was wirklich mit dem Vater los war, lässt sich nicht mehr ergründen. Noch als Erwachsener wünscht er sich manchmal die Ermutigung durch den Vater, gerade wenn er sich im Internet zu verlieren scheint: „Du machst das schon alles richtig: Dein Vater“.
Die eigene Vaterschaft ist eine Aufgabe, an der er zu scheitern fürchtet. Er möchte ein guter Vater sein, hat aber Ängste, er könnte seinem Kind dasselbe antun, wie sein Vater es ihm angetan hat. Mit den Augen das Kindes sieht er sich als alkoholabhängig, sprunghaft, nicht geerdet in der Realität.
Soll er das Kind vor so einem Schicksal bewahren? Beklemmend die Szene, in der er Tötungsfantasien hat.
Aus der aktuellen Roadstory schweift der Erzähler immer wieder ab in die tiefere Vergangenheit, aber auch in seine aktuelle Lebenssituation.
So führt der Besuch im Heim bei der dementen Mutter zu einem anderen Thema des „Familienbla“. Die Familie der Mutter wurde aus dem Sudetenland vertrieben. Die in der Familie verbreitete Legende lässt die Haltung der Familie zu den Nazis im Nebel. Welche Soldaten hat die Großmutter versteckt? „Die Großmutter als Beschützerin der Wehrmacht? Die Großmutter als Patronin des Widerstands?“ Die Familienlegende verbreitet das Elend der Vertreibung; die Züge, die ein paar Jahre zuvor in den Osten gingen, werden nicht erwähnt.
Es scheint unmöglich, den Teufelskreis von Lüge und Gewalt zu durchbrechen, zu sehr erkennt der Erzähler an sich selbst die gleichen Verhaltensmuster wie bei seinem Vater.
Oder gibt es doch einen Ausweg? Der Schluss gibt Anlass zur Hoffnung, als der Vater dem kleinen Sohn gegenüber zur Wahrheit findet. Der Großvater war nicht krank, er hat sich umgebracht.
Bov Bjerg gelingt mit diesem Roman ein Einblick in die innere Zerrissenheit des Erwachsenen, der die Herkunft nicht leugnen kann, der die eigenen Traumata seinerseits an den Sohn weiterzugeben droht.
Dabei ist die Erzählung nie lamentierend, sondern getragen von einem kritischen Blick auf die eigene Person, aber auch auf ein satt-selbstzufriedenes Bildungsbürgertum, das sich mit verächtlichem Blick abschottet von gesellschaftlichen Schichten, die nicht privilegiert sind, sondern die „Drecksarbeit“ machen. In den kritischen Blick gerät auch der moderne Kunstbetrieb. War Kunst für das bildungshungrige Arbeiterkind und seinen Freund einst ein Weg aus den Einschränkungen durch die Herkunft, sieht er jetzt „Kunst als Gelegenheit, sich kultiviert zu geben. Fauler Zauber und Flaschenbier“. „Kunst ohne Nimbus“ dagegen erlebt er mit dem Sohn im Steinzeitmuseum. Radikale Thesen also, die die Diskussion herausfordern.
Bjerg erzählt assoziativ. Sowohl die sinnlichen Eindrücke während der Fahrt als auch die unmittelbare Begegnung mit dem kleinen Sohn öffnen Erinnerungsfenster, die oft bruchstückhaft bleiben, aber in ihrer Bedeutung für die Lebensgeschichte des Erzählers sichtbar werden. Kaleidoskopartig entfaltet sich so ein Gesamtbild des sozialen Kontextes einer Arbeiter-Kindheit in Nachkriegsdeutschland.
Die sprachliche Verdichtung fordert die Leser heraus, Leerstellen zu füllen und zu deuten; Leitmotive verbinden die unterschiedlichen Erzählebenen von Erinnerung, Wiederbegegnungen und der sich verändernden Beziehung zwischen dem Erzähler und dem Kind.
Am Ende bleibt die Hoffnung auf Durchbrechen des selbstmörderischen Teufelskreises. Die Sorge um das Kind und dessen Fragen nach der Wahrheit erscheinen als Ausweg aus dem selbstbezüglichen Lebenszweifel.
Insgesamt ist das ein eindringlicher und unbedingt lesenswerter Roman, der die Leser hineinzieht in die Ambivalenzen, Ängste und Nöte des Erwachsenen wie auch in die ganz gegensätzliche Sicht des Kindes, das diese Welt noch neugierig und mutig entdecken will.
Der Roman ist im Claassen Verlag erschienen, hat 267 Seiten und kostet 22 Euro.
Elke Trost

No comments yet.