Das Theater ist – wie die Religion – eine „urmenschliche“ Institution, die sich letztlich spielerisch mit dem Unfassbaren und Unbenennbaren der Welt auseinandersetzt. Mag zu Beginn der menschlichen Bewusstseinsbildung der Unterschied zwischen Theater und Religion noch sehr gering gewesen sein – wir haben leider keine Aufzeichnungen aus den frühesten Epochen -, so hat sich das mimetische Moment – nie Nachahmung – im Laufe der letzten zweieinhalb Jahrtausende immer mehr verselbständigt und ins Säkulare verschoben.
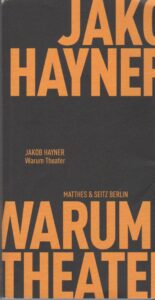
Jakob Hayner betrachtet die Situation des heutigen Theaters nicht zuletzt aus der Rückschau auf diese lange Epoche theatralischer Aktivitäten und sieht einen eindeutigen Verfall. Er beschwört zwar nicht das antike Theater Griechenlands als „gute alte Zeit“, aber eine ähnliche Vorstellung geistert doch durch seine Zeilen, weil dort noch existenzielle Fragen ohne Tabus und Selbstzensur behandelt wurden. Hayners Ansatz ist von vornherein ein sehr moderner. Er sieht überall im Theaterbetrieb eine höhere Selbstzufriedenheit walten, die zumindest unbewusst ein „immer weiter so“ unterstütze. Er will die Selbstgewissheit des Theaters, die diesem letztlich nur schade, durchbrechen, denn nur radikaler (Selbst-)Zweifel könne Sinn und Zweck des Theaters sein. Dabei unterliegt er jedoch selbst eben dieser Selbstgewissheit, wenn auch in anderer Form.
Hayner geht davon aus, dass wir in der schlechtesten aller möglichen Welten leben, nämlich im (neoliberalen) Spätkapitalismus. Er sieht die „Erbsünde“ des Kapitalismus als gegeben und stellt seine ausgeprägte linke Weltsicht gar nicht mehr zur Debatte. Der existierende Kunstbetrieb – hier das Theater – ist für ihn vom Marxschen Warenwert geprägt und geht damit an den wahren Bedürfnissen der Menschen vorbei. Zweifel sind hier nicht angebracht, es stellt sich hier nur die Frage, was zu tun ist. Abgesehen von der unfreiwilligen Komik, die der tendenzielle Abgesang des Wortes „Spätkapitalismus“ aus dem Munde eines Linken angesichts der letzten vierzig Jahre des „real existierenden Sozialismus“ in sich birgt, bleibt auch die Frage nach der Alternative offen. Zwar geht es in diesem Buch nicht um die Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus, doch die einseitige Abwertung des ersteren und der Verzicht auf die Skizzierung einer konkreten Alternative sowie auf den Begriff „Sozialismus“ lässt hier eine Leerstelle. Denn wenn man die radikale Befreiung des Theaters aus den Klauen des Kapitalismus verlangt, sollte man auch die gesellschaftspolitische Richtung vorgeben können. Es ist zwar verständlich, dass Hayner angesichts des desaströs-epigonalen Zustands des Sozialismus – Nordkorea, Venezuela und von China ganz zu schweigen – einen Verweis auf diesen vermeidet, doch was dann?
Soviel nur zu dem ideologischen Hintergrund dieses Buches und seines Autors, der ansonsten seinen Hegel gelesen hat und Marx anscheinend immer noch als unberührbare Autorität ansieht. Dessen Zitate setzt er durchgehend bestätigend ein und lässt dabei keinen Schimmer des Zweifels durchblicken. Diese Vorbemerkungen scheinen uns notwendig, da Hayners Buch auch in seinen ästhetischen Aspekten in erster Linie politisch ist, frei nach dem Motto „Alles Ästhetische ist politisch“.
Hayner attestiert dem heutigen Theater vier Säulen der Weltinterpretation: die „symbolische Aktion“, z. B. die Erstürmung repräsentativer staatlicher Gebäude („Bastille!), das „Theater der ersten Person“ zwecks Herausstellung des individuellen Leids (am Kapitalismus), die Auseinandersetzung mit Gruppenidentitäten (Diskriminierung von Hautfarbe, Religion und Geschlecht) sowie die Herausstellung traumatischer Situationen (Vergewaltigung, Völkermord etc.). Allen vier Säulen unterstellt er grundlegende Mängel aufgrund mangelnder Durchdringung des Sachverhalts oder des Verzichts auf grundlegende Hinterfragung. Im ersten Falle bleibe alles im Symbolischen stecken, ohne die wahren Ursachen zu benennen, im zweiten Fall werde das Leid individualisiert statt es zu verallgemeinern, im dritten betreibe das Theater quasi Klientelpolitik, statt wiederum die wahren Ursachen herauszuarbeiten, und im letzten Fall beklagt er, dass letztlich das Nachspielen grausamer Aktionen stets als „Spiel“ kenntlich gemacht und damit das eigentliche, konkrete Ereignis bagatellisiert werde. Das Entsetzen werde durch den Verweis auf das Bühnenspiel implizit eingehegt.
Das Erstaunliche an dieser Einteilung ist nicht eine Verzerrung oder gar bösartige Unterstellung, sondern die Pauschalität, in der Hayner durch seinen apodiktische Duktus sämtlichen Stücken und deren Interpretationen diese Mängel unterstellt. Das bedeutet natürlich auch, sämtliche positiven, berührten und beeindruckten Kritiken beliebiger Inszenierungen à priori als ebenso oberflächlich abzukanzeln, von den nur vermeintlich engagierten Regisseuren und Schauspielern und dem Publikum ganz zu schweigen. Damit sei nicht bestritten, dass es solche zu kurz greifenden Interpretationen auf der Bühne durchaus gibt, doch die pauschale Verdammung der gesamten (deutschsprachigen) Theaterlandschaft scheint doch zumindest sehr gewagt.
Geradezu dialektisch – im fragwürdigen Sinne – geht Hayner auch mit dem Begriff der (Ir-)Rationalität um. Die heute um sich greifende Tendenz – soll man sagen Mode? – zu Performances anstelle des rationalen Diskurses verweist er ins Reich des falschen Romantisierens, denn die Performance stelle den Anspruch der unmittelbaren Erzeugung von Wirklichkeit statt kalt-rationaler Diskussion, liefere aber nur falsche Mystifizierung statt rückhaltloser Offenlegung der wahren Gründe für die wachsende Entfremdung des menschlichen Lebens, womit er wiederum auf den Waren- und Konkurrenzdruck des (Spät-)Kapitalismus verweist.
Später verwahrt er sich gegen die Abwertung der Mimesis, d.h. der „Nachahmung“ (der Welt und des Lebens) als Grundprinzip des Theaters durch die Forderung nach totaler politischer Diskussion auf der Bühne, indem er nun die Mimesis, richtig genutzt, als Schöpfer einer neuen Metaphysik entdeckt, die das „Andere“ zu dem Existierenden erahnen lässt. Das Theater soll aus seiner Sicht diese Utopie des radikal Anderen aus den Stücken und deren rückhaltloser Interpretation gewinnen und sichtbar machen. Doch gerade dieses „Andere“ kann (und will) Hayner nicht konkretisieren. Es muss nur eine radikale Alternative zum Kapitalismus sein. Dieses Vage, um nicht zu sagen „Schwammige“ hat er jedoch der Performance gerade vorgeworfen, und das mit einigem Recht.
Zutreffend hält Hayner fest, dass Philosophie und Kunst zeigen (sollen), „dass das, was ist, nicht alles ist“, dass alles auch ganz anders sein könnte. Diese Aussage ist jedoch erst einmal allgemein und teilt die existierende Welt nicht von vornherein in Schwarz und Weiß ein. Das vieles im Argen liegt und Verbesserungen denkbar sind, steht außer Frage, aber dazu gehören auch Entwürfe und Ideen für dieses „Bessere“. Wer dem Theater vorwirft, diese Idee der Utopie nicht zu liefern, aber selbst keine dazu liefert, wirkt nicht gerade sehr glaubwürdig. Später verweist er dann an einer Stelle doch noch explizit auf den Kommunismus als „hellen Schein“ der Utopie, doch bezieht er sich dabei auf Walter Benjamin, der noch in der Euphoriephase des Kommunismus lebte und schrieb, vom Terror des Sowjetsystems nichts wusste (oder nichts wissen wollte) und sich eben historisch auch irren konnte. In diesem Zusammenhang zitiert Hayner des Öfteren auch Adorno und Horkheimer, die in frühen Jahren ebenfalls den Sozialismus/Kommunismus bejubelten, die schrecklichen Seiten nicht sehen wollten und den selbst verschuldeten Absturz nicht mehr erlebten. Es fragt sich daher, wie belastbar die Aussagen dieser intellektuellen Heroen zu bestimmten historischen Entwicklungen überhaupt noch sind. Dass Adorno zum Ästhetischen viele richtungsweisende Gedanken entwickelt hat, bleibt dabei unbestritten.
Im letzten Kapitel ruft Hayner dann zur „Erneuerung der Idee des Theaters“ auf. Seinen Ausführungen dazu kann man über weite Strecken durchaus zustimmen, da sie eher grundlegend für das Selbstverständnis des Theaters sind. Natürlich kann man sich fragen, ob das Theater alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen nach deren(!) Vorstellungen bedienen soll, will sagen belanglose Kalauer-Komödien oder Musicals, und natürlich soll das Theater die Menschen konfrontieren mit den Zuständen in dieser Welt. Das sollte jedoch nicht unter einer vorgegeben „Marschroute“ mit dem Spätkapitalismus als zu bekämpfendem Ziel erfolgen, sondern eine offene Theaterarbeit ermöglichen. Doch so, wie jemand mit einem Hammer in jedem Gegenstand den Nagel sieht, erkennt jeder überzeugte Antikapitalist auch in jedem Leid und Elend den (Spät-)Kapitalismus als Verursacher. Schade um die Verkürzung der Sicht auf das Theater in diesem ansonsten in vielen Punkten originellen und ideenreichen Buch.
Das Buch ist im Verlag Matthes & Seitz erschienen, umfasst 171 Seiten und kostet 15 Euro.
Frank Raudszus

No comments yet.