Das Programm des 8. – und damit letzten – Sinfoniekonzerts des Staatstheaters Darmstadt kontrastierte deutlich mit dem hochsommerlichen Wetter: keine leichte, entspannende „Ausklangs“-Musik, sondern wahrlich schwere Kost. Nach Karlheinz Stockhausens elektronischer Komposition „Gesang der Jünglinge“ erklang Gustav Mahlers 3. Sinfonie in d-Moll. Dirigent des Abends war Johannes Harneit.
Die Erzeugung musikalischer Klänge durch elektronische Geräte motivierte bereits in den 50er Jahren viele Komponisten, auf diesem Feld zu experimentieren, weil man damit das – gefühlte! – Korsett der festen Tonhöhen und Harmonien sprengen konnte. Karlheinz Stockhausen bewies dies Mitte der 50er Jahre mit seiner Komposition „Gesang der Jünglinge“ auf spektakuläre Weise. Dieses Werk kommt aufgrund der technologischen Logik ganz ohne Orchester aus, und so erschien Dirigent Johannes Harneit zu Beginn ganz alleine und ohne Dirigentenstab auf der Bühne, um die akustische Konstellation sowie die Musik kurz zu erklären.
Vier im Raum verteilten Lautsprecher erzeugen einen dreidimensionalen Klangraum, in dem der elektronisch bearbeitete Gesang eines zwölfjährigen Sängers zu hören ist. Stockhausen verzerrt und zerlegt diesen Gesang mit elektronischen Mittel auf vielfältige Weise, so dass sich das Stück wie ein akustisches Puzzle ausnimmt. Die klassische Liedstruktur mit Haupt- und Nebenthema hat ausgedient, es gilt nur der punktuelle Klangeffekt. Dabei werden die kurzen Fragmente des kindlichen Gesangs von zusätzlichen elektronischen Klangmustern begleitet, die oftmals an Instrumente – etwa den Bass – erinnern, diese aber nicht bewusst nachbilden. Überblendungen der Stimme mit sich selbst, Verdichtungen und Verkürzungen sowie Änderungen der Dynamik lassen ein akustisches Konglomerat entstehen, das im Laufe der fünfzehnminütigen Aufführung trotz der scheinbaren Strukturlosigkeit eine ganz eigene und homogene Ausdruckskraft entwickelt. Mit Musik im herkömmlichen Sinne – sei es „E“ oder „U“ – hat dieses akustische Erlebnis nicht viel zu tun, aber es ist doch viel mehr als nur die Spielerei eines Elektronikfans. Anhand dieser Musik wird erst deutlich, dass unser (klassisches) Musikverständnis auf vielerlei Einschränkungen beruht.
Die anschließende 3. Sinfonie in d-Moll von Gustav Mahler aus den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts benötigte dann wieder ein großes Orchester, wie man es aus dieser – durchaus dem Größenwahn zuneigenden – Zeit kennt. Neben den einschlägigen Instrumenten waren zwei Harfen, echte Glocken und mehrere große Chöre auf der Bühne vertreten.
Mahlers Musik löst sich weitgehend von dem klassischen Schema der Viersätzigkeit und der weitgehend standardisierten Abfolge schneller und langsamer Sätze. Nicht nur besteht die 3. Sinfonie aus formal sechs Sätzen, sondern diese sind auch in Länge und Ausgestaltung höchst asymmetrisch. So zieht sich der Kopfsatz über mehr als eine halbe Stunde hin, die Sätze 4 und 5 bestehen aus orchestral unterstütztem Gesang, und die Sinfonie endet – ganz ungewöhnlich – in einem extrem langsamen Satz. Hatte schon die Spätromantik das klassische Konzept beliebig gedehnt, sprengt Mahler es endgültig, da seine Musikauffassung strukturelle Vorgaben als Einschränkung empfand. Musik wurde in Mahlers Zeit zur Projektionsfläche für alle menschlichen Emotionen und Visionen, die man nicht in Schemata pressen kann.
Der erste Satz beginnt mit einem ausgedehnten, fanfarenartigen Horn-Thema – Albtraum aller Hornisten. Hier jedoch meisterte der Hornisten diese Vorstellung des Themas auf souveräne Weise. Die klassische Struktur des Sonatenhauptsatzes lässt sich kaum noch nachvollziehen, derart wandern die Themen und Motive. Man gewinnt eher den Eindruck einer weit ausgedehnten Wanderung durch eine musikalische Landschaft mit stets neuen Eindrücken und Überraschungen. Da erkling einmal kurz ein Trauermarsch mit leisen Trommelwirbeln, dann wieder gewinnen marschartige Rhythmen und Motive die Oberhand bis hin zur parodistischen Verzerrung der Militär- oder Zirkusmusik. Mahler wandert durch (fast) alle Genres der Musik seiner Zeit, jedoch nie in platter Nachahmung, sondern stilisierend, überhöhend und stellenweise karikierend. Dieser Satz spiegelt in ausgeprägter Form das hohe – und auch hohle – Pathos des ausgehenden 19. Jahrhunderts wider, gepaart mit einer nostalgischen Rückschau auf eine vermeintlich gute alte Zeit und einer tiefen Sehnsucht nach Einfachheit und Erlösung. Diese Sehnsucht entlädt sich in einem gewaltigen Crescendo und einer nicht enden wollenden Kette von Schlussakkorden mit Trommelwirbeln.
Dagegen wirkt der zweite Satz im „Tempo die Minuetto“ geradezu lyrisch-verspielt. Doch auch das lässt sich als nostalgische Rückschau auf bessere Zeiten verstehen, als die Industrialisierung noch nicht jeden Stein umgedreht hatte. Leichtfüßig und spritzig kommt vor allem das schnelle Trio daher, und der Zuhörer wird in eine völlig verschiedene Welt gegenüber dem ersten Satz versetzt. Der dritte Satz, ein Scherzando, verstärkt diesen Eindruck noch, beginnt er doch geradezu spielerisch, bis das „Posthorn“-Thema aus dem „Off“ hinter der Bühne ertönt. Dieses Thema führt wiederum in die Vergangenheit, weckt es doch Assoziationen an Postkutschen (und Schubert) aus Zeiten vor der Eisenbahn, dem Dampfschiff und dem Telegraphen. Über weite Strecken dominiert dieses romantische Motiv den Satz, ehe dieser plötzlich und hart endet.
Der vierte und fünfte Satz sind beide dem Gesang gewidmet. Zuerst trug die Altistin Evelyn Krahe die Zeilen „O Mensch! Gib Acht!“ aus Nietzsches „Zarathustra“ vor, dann folgte der stimmstarke Frauenchor mit „Armer Kinder Bettlerlied“ aus Mahlers „Des Knaben Wunderhorn“. Tiefe Gläubigkeit und Beschwörung göttlicher Gnade ersetzen die mal heitere, mal parodistische Rückschau in die Vergangenheit, das Spielerische ist endgültig vergangen. Evely Krahe verlieh Nietzsches Worten fast schon apokalyptische Bedeutung, und der Chor drehte diese Bedeutungsschwere anschließend kraftvoll und stimmstark in hoffnungsvolle Gläubigkeit.
Der letzte Satz nimmt diese jenseitige Stimmung auf und verdichtet sie mit instrumentalen Mitteln, wobei jedoch durchgehend der Liedcharakter betont und verstärkt wird. Das Orchester wird zur virtuellen menschlichen Stimme, nimmt die Emotionen der vorangegangenen Gesangspartien auf und führt sie mit höchster Intensität und dichter Klangentwicklung fort. Man kann diesen Satz durchaus als Quintessenz der ganzen Sinfonie verstehen, gerade, weil er nicht in den donnernden Schlussakkord mündet – sei er nun jubelnd oder verzweifelnd.
Das Orchester unter der Leitung von Johannes Harneit leistete an diesem Abend Schwerstarbeit und ließ dabei keinen Augenblick nach. Wohin man auch schaute und lauschte, herrschte Präzision und Spannung, so dass in gewissem Sinn die anschließende Ehrungen einzelner Solisten – Horn, ,Posaune – eigentlich dem gesamtem Orchester galten.
Das Publikum zeigte sich begeistert und spendete lang anhaltenden Beifall, hatte aber auch selbst einen anstrengenden Abend mit hohen Anforderungen an die Aufnahmefähigkeit hinter sich.
Frank Raudszus

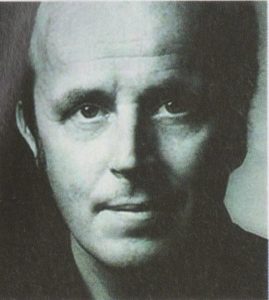

No comments yet.