Der 1828 im Alter von einunddreißig Jahren verstorbene Franz Schubert stand den überwiegenden Teil seines Lebens – objektiv und vor allem subjektiv – im Schatten Beethovens. Schlimmer noch als im Falle eines bereits verstorbenen Vorbildes erlebte und erlitt er Beethovens Größe und Einfluss während seiner gesamten musikalischen Karriere. Das bewunderte Vorbild war ihm stets zwanzig Jahre voraus.
Hans-Joachim Hinrichsen ignoriert diesen Umstand zwar nicht, stellt ihn aber auch nicht in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Ihm geht es nicht um psychologische Befindlichkeiten, auch wenn er ihre Bedeutung nicht unterschätzt, sondern um konkrete Akltivitäten und – ja! – Strategien Schuberts, um dieser Situation gerecht zu werden.
Das Buch ist zwar konsequent chronologisch organisiert, jedoch weniger wegen des privaten Lebenslaufes seines Protagonisten als vielmehr wegen der gezielten künstlerischen Entwicklung, die Schubert durchlaufen hat. Zwar kommen alle Freunde Schuberts – Spaun, Hüttenbrenner, Schober – in angemessener Weise vor, jedoch nie als menschelnde Figuren sondern stets als Förderer mit künstlerischer Motivation. Der nüchterne, auf die musikalische Analyse konzentrierte Stil des Autors mag manchen Liebhaber von Künstlerbiographien – vor allem Franz Schuberts! – enttäuschen, stellt sich jedoch schon bald als eine der wesentlichen Stärken dieses Buch heraus.
Hinrichsen beschreibt Schubert als „verhinderten“ Generalisten, der von seiner Umgebung lange Zeit und ohne böse Absichten auf das Kunstlied reduziert wurde. Gerade sein leichthändiger Erfolg auf diesem Gebiet bereits in jungen Jahren trug ihm diesen Ruf nicht nur zu Lebzeiten sondern auch lange danach ein. Hinrichsen zeigt deutlich, dass Schubert von Anfang an auf allen musikalischen Gebieten mit seinem großen Vorbild Beethoven mithalten wollte, und das nicht nur aus vordergründig kompositorischem Ehrgeiz, sondern aus tiefstem musikalischen Antrieb. Die frühen Streichquartette, Sinfonien und Klavierwerke zeigen dies deutlich. Dass er mit diesen Werken den „Musikmarkt“ so gut wie nicht erreichte, lag nicht an der mangelnden Qualität, sondern an Schuberts fehlendem sozialen Netzwerk. Das war von Beginn an auf Musik im Umkreis der Familie und des Freundeskreises beschränkt. Im Unterschied zu Mozart und Beethoven verfügte Schubert über keinerlei Kontakte zum Adel und zum Hof.
Darüber hinaus nahm die finanzielle und gesellschaftliche Kraft des Adels infolge der napoleonischen Kriege – sprich: Niederlagen – dramatisch ab, so dass von hier aus auch weniger Nachfrage existierte. Mozart und Beethoven hatten ihren Ruf noch zu besseren Zeiten erworben und gefestigt. Das aufkommende bürgerlich-kaufmännische Kulturleben musste finanzielle Risiken kalkulieren und beschränkte sich daher gerne auf Zugnummern wie Rossini oder Paganini, um nur zwei Namen zu nennen. Ein „Liederschreiber“ aus der Wiener Vorstadt hatte da keine großen Chancen.
Die traditionelle Schubert-Literatur spricht von einer „Krise“ zwischen 1820 und 1824. Hinrichsen belegt an vielen Beispielen, dass es sich hier nicht um eine schöpferische Krise, sondern um einen Wechsel des Schwerpunkts handelte. Die zahlreichen Fälle abgebrochener Kammermusik-Werke sind einerseits darauf zurückzuführen, dass Schubert neue musikalische Wege abseits des (Beethovenschen) „mainstreams“ suchte, andererseits ganz banal darauf, dass er sich während dieser Jahre intensiv um die Oper bemühte. Doch letztlich fehlten ihm für diese Königin der (damaligen) Musiksparten einfach die sozialen Netzwerke, um kostspielige Operninszenierungen zu platzieren. Dazu kam noch persönliches Pech bei den wenigen Beziehungen, die er hatte. Hinrichsen betont dabei den nicht von der Hand zu weisenden musikalischen Wert von Schuberts Opernmusik, die jedoch nicht immer den eher traditionellen Geschmack des Hofes traf.
Als Schubert nach 1824 seinen Schaffensschwerpunkt wieder auf die anderen Bereiche – Sinfonie, Kammermusik, Lied – verlegte, kam der Erfolg nahezu zwangsläufig. Hinrichsen zeigt klar, dass Schubert in seinen letzten Lebensjahren einem künstlerischen Höhepunkt zustrebte, der sich in seinen beiden großen Sinfonien – der Achten („Unvollendete“) und der Neunten -, den späten Streichquartetten, den Klaviersonaten und der „Winterreise“ niederschlug. Die bittere Ironie des Lebens wollte es, dass er starb, als er vor dem (inter)nationalen Durchbruch stand.
In einem Abschlusskapitel über die Schubert-Rezeption weist Hinrichsen darauf hin, dass Schubert – wohl auch wegen seines geringen Bekanntheitsgrades zu Lebzeiten – im 19. Jahrhundert lange Zeit als sentimentaler Liedkomponist und Salonmusiker betrachtet wurde. Seine neuartige – in Hinrichsens Worten „epische“ – Kompositionsweise, die ihm von Schumann das (oft missverstandene) Lob „himmlischer Längen“ eintrug, wurde nicht als Alternative zum dramatischen, zielgerichteten Stil Beethovens verstanden, sondern als seichte Unterhaltung abgetan. Erst im späten 19. und dann im 20. Jahrhundert entdeckte die Musikwelt den wahren Franz Schubert und stellte ihn auf Augenhöhe neben Haydn, Mozart und Beethoven.
Es ist das Verdienst Hans-Joachim Hinrichsens, die Hintergründe und die Struktur dieser musikalischen Biographie auf hohem intellektuellen und musikwissenschaftlichen Niveau und zugleich verständlich und unterhaltsam zu präsentieren. Nicht nur Schubert-Liebhaber, sondern alle ernsthaften Musikfreunde sollten sich dieses kleine Bändchen zu Gemüte führen.
Das Buch ist im Verlag C.H. Beck erschienen, umfasst 128 Seiten und kostet 8,95 Euro.
Frank Raudszus

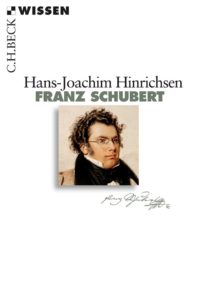
No comments yet.