Der Bevölkerung des amerikanischen Kontinents vor dessen Entdeckung durch Christoph Kolumbus eilt der Ruf voraus, quasi in paradiesischer Eintracht mit der Natur gelebt und diese nicht – wie die Europäer – unterworfen zu haben. Das gilt vor allem für die nordamerikanischen Indianer, die man nur als Jäger kannte, nicht aber als Landwirte. Dass Karl May diese Sicht mit seiner Trivialliteratur noch befeuert hat, ist dabei eher ein ironisches Aperçu ohne geistesgeschichtliche Bedeutung. Dagegen sieht man die mittel- und südamerikanischen Vertreter der Urbevölkerung – die Mayas und die Inkas – als höher stehende Zivilisationen, da hier eine Romantisierung wie bei den Nordamerikanern aufgrund der unübersehbaren Bauten nicht möglich war. Diese tendenziell contrafaktische Sicht auf die Urbevölkerung eines ganzen Kontinents beruht zweifellos auch auf dem schlechten Gewissen der Europäer, die als Eindringlinge dort nicht nur mit unvorstellbarer Grausamkeit gehaust sondern auch systematisch die lokalen Bevölkerungen ausgerottet haben.
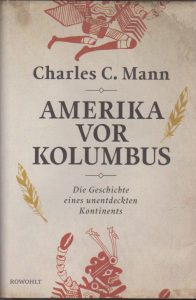 Charles C. Mann, von Hause aus Journalist, hat sich erst in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts für die Frühzeit seines Kontinents interessiert, konnte dann jedoch nicht mehr von diesem faszinierenden Thema lassen. Sein Buch ist ein eher Überblick über die Resultate der einschlägigen archäologischen, anthropologischen und historischen Forschungen der letzten einhundert Jahre. Dabei fehlt ein großer erzählerischer Rahmen wie in Europa, wo sich die Entwicklung der menschlichen Zivilisation um das Mittelmeer herum abgespielt und dabei vom Zweistromland mit Babylon und anderen frühzeitlichen Stätten über Ägypten, Persien, Griechenland, Rom und die keltisch-germanischen Stämme bis hin zum europäischen Mittelalter und darüber hinaus eine große, zusammenhängende Erzählung geschaffen hat. Diese fehlt auf dem amerikanischen Kontinent aus verschiedenen Gründen: es gibt keinen wärmenden Golfstrom, und auch ein zentrales „Binnenmeer“ wie das Mittelmeer fehlt, um das sich die Völker ansiedeln und auf dem sie miteinander Handel treiben konnten. Die angrenzenden Ozeane waren für weiträumigen Verkehr zu gefährlich, und die Geologie der Landmassen erschwerte weiträumigen Austausch durch unwirtliche Bedingungen wie Dschungel oder Sandwüsten und Gebirge. So bildeten sich auf dem amerikanischen Kontinent nur Zivilisationsinseln, von denen es jedoch wesentlich mehr gab, als man noch vor einem halben Jahrhundert annahm.
Charles C. Mann, von Hause aus Journalist, hat sich erst in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts für die Frühzeit seines Kontinents interessiert, konnte dann jedoch nicht mehr von diesem faszinierenden Thema lassen. Sein Buch ist ein eher Überblick über die Resultate der einschlägigen archäologischen, anthropologischen und historischen Forschungen der letzten einhundert Jahre. Dabei fehlt ein großer erzählerischer Rahmen wie in Europa, wo sich die Entwicklung der menschlichen Zivilisation um das Mittelmeer herum abgespielt und dabei vom Zweistromland mit Babylon und anderen frühzeitlichen Stätten über Ägypten, Persien, Griechenland, Rom und die keltisch-germanischen Stämme bis hin zum europäischen Mittelalter und darüber hinaus eine große, zusammenhängende Erzählung geschaffen hat. Diese fehlt auf dem amerikanischen Kontinent aus verschiedenen Gründen: es gibt keinen wärmenden Golfstrom, und auch ein zentrales „Binnenmeer“ wie das Mittelmeer fehlt, um das sich die Völker ansiedeln und auf dem sie miteinander Handel treiben konnten. Die angrenzenden Ozeane waren für weiträumigen Verkehr zu gefährlich, und die Geologie der Landmassen erschwerte weiträumigen Austausch durch unwirtliche Bedingungen wie Dschungel oder Sandwüsten und Gebirge. So bildeten sich auf dem amerikanischen Kontinent nur Zivilisationsinseln, von denen es jedoch wesentlich mehr gab, als man noch vor einem halben Jahrhundert annahm.
Der Autor beginnt seine Zeitreise im Nordosten der heutigen USA, wo vor vierhundert Jahren die Pilgervätern landeten und auf eine gewachsene Indianerkultur trafen (der Begriff „Indianer“ ergab sich aus Kolumbus´ irrtümlicher Annahme, in Indien gelandet zu sein). Die Einwohner erlagen der verständlichen Annahme, dass diese kleine Schar darbender Siedler keine Gefahr darstelle, und halfen ihnen sogar, wurden dann aber von deren Krankheiten in geradezu apokalyptischem Ausmaß dahingerafft. Charles C. Mann erklärt sich diese immunologische Wehrlosigkeit durch die genetischen Einschränkungen der amerikanischen Urbevölkerung, die in der frühen Steinzeit aus Sibirien über die – erdgeschichtlich kurzfristig – trocken gefallene Beringstraße nach Nordamerika eingesickert waren. Dieses lässt sich durch den genetischen Vergleich mit sibirischen Stämmen belegen. Auch diese hatten wegen der Weite Sibiriens wenig Kontakt zu anderen Volksstämmen und konnten daher – im Gegensatz zu europäischen Volksstämmen – keine genetische Vielfalt entwickeln, die ihnen Immunschutz verliehen hätte. So waren die Nachkommen dieser sibirischen Stämme auf dem amerikanischen Kontinent den Krankheitserregern der immunologisch abgehärteten Europäern hilflos ausgeliefert.
Charles C. Mann zeigt die katastrophalen Folgen dieser Konstellation nicht nur an dem ersten Beispiel sondern an vielen anderen amerikanischen Völkern auf. So gab es auch im südlichen Mittelwesten der heutigen USA – am Mississippi – vor der Ankunft der Europäern ausgedehnte Zivilisationen, die bereits eine ausgefeilte Landwirtschaft betrieben, aber nach dem ersten Zusammentreffen mit europäischen Soldaten oder Siedlern in historisch kürzester Zeit zugrunde gingen. Da die Städte und Dörfer dieser Zivilisationen meist aus naturnahen Baustoffen wie Holz erbaut waren, zerfielen sie nach dem Aussterben der Bevölkerungen sehr schnell. Die Entdeckung dieser Stätten im 20. Jahrhundert ergab sich anfangs aus reinen Zufällen, und die ersten Funde von Artefakten und Behausungen wurden anfangs auch von der wissenschaftlichen Welt rundweg abgelehnt, weil sie nicht in das Bild des einfachen – wenn auch edlen – „Wilden“ passten. Der Autor zeigt plastisch das Ausmaß der geradezu ideologischen Auseinandersetzungen, die teilweise noch bis heute andauern.
Die Ideologie spielt dabei bereits beim Einsickern der Sibirier eine große Rolle. Fast zeitgleich mit der klimatisch bedingten Lücke zwischen zwei großen Eisgürteln, durch die die neuen Menschen in den Kontinent strömten, lässt sich archäologisch ein ausgeprägtes Artensterben bei den Tieren nachweisen. Knochen- und Waffenfunde legten den Schluss nahe, dass die Zugereisten unter den keinen Feind gewohnten Tieren blindwütige Massaker veranstalteten und diese damit zum Aussterben verurteilten. Der Protest dagegen kam nicht von Archäologen, die sachlich gegen die Interpretation der Fundstücke argumentierten, sondern von Aktivisten, die ihr Bild vom ökologisch korrekten Frühbewohner Amerikas nicht aufgeben wollten.
Ähnliches gilt von den Mayas, die – auf der Halbinsel Yucatan beheimatet – offensichtlich ihre eigenen ökologischen Lebensbedingungen zerstörten, wenn auch unabsichtlich. Die Ausgrabungen legen diese Interpretation jedenfalls nahe. Auch hier kämpfen Umweltaktvisten erbittert gegen die Archäologen. Die Inkas dagegen, die an der Pazifikküste das Gebiet des heutigen Chiles und Perus bewohnten, kämpften erstens gegenseitig erbittert um die Macht, obwohl sie vor der Ankunft der Spanier eine hoch entwickelte, sehr leistungsfähige Zivilisation erschaffen hatten. Bereits geschwächt durch die internen Kämpfe, fielen sie nach Pizarros Ankunft ebenfalls den Krankheiten der Europäer zum Opfer. Diese brauchten also gar nicht mit übergroßer Brutalität ein ganzes Volk zu massakrieren – ihre Viren schafften das ohne ihr aktives Wissen schneller und wesentlich effizienter.
Auch dem Amazonas widmet der Autor ein ausführliches Kapitel. Bis heute herrscht – auch in wissenschaftlichen Kreisen – die Meinung vor, im dicht bewaldeten Amazonasbecken habe es außer überschaubaren „Indianer“-Stämmen keine bedeutenden Zivilisationen gegeben. Vor allem ausgedehnte Landwirtschaft habe es hier nie gegeben. Neuer Forschungen legen jedoch die Vermutung nahe, dass hier durchaus hoch stehende Zivilisationen mit einer ausgefeilten, die Eigenarten des Regenwalds berücksichtigenden Landwirtschaft die Landschaft bewusst geformt haben. Innerhalb der Wissenschaft bekämpfen sich bis heute bei dieser Frage zwei Lager, und der Kampf ist noch nicht entschieden. Auch hier greifen wieder Umweltaktivisten in die Diskussion ein und bekämpfen die neueren Erkenntnisse mit dem Argument, durch solche Veröffentlichungen ermutige man rücksichtslose Bauunternehmer noch, den Regenwald abzuholzen.
Charles C. Mann weist auch auf die besonderen Schwierigkeiten der Altertumsforschung aufgrund fehlender Schrift hin. Die „Indianer“ Nordamerikas kannten überhaupt keine Schrift, so dass die gesamte Entwicklung allein aus den Funden oder aber aus den zweifelhaften Berichten der Europäer nach der „Entdeckung“ rekonstruiert werden muss. Die Maya in Mittelamerika verfügten zwar über ein Schriftsystem, doch die jeweiligen Unterlagen – meist ein weicher Stein – sind durch Hitze und Feuchtigkeit weitgehend zerstört oder zumindest unleserlich. Die Inkas in Südamerika verfügten über ein Zeichensystem auf Basis kompliziert miteinander verknüpfter Fäden, die man jedoch erst in letzter Zeit als – bsiher noch nicht entschlüsseltes – Schriftsystem interpretiert. So steht die Archäologie und Altertumsforschung auf dem amerikanischen Kontinent immer noch vor hohen Hürden, allerdings auch vor großen Möglichkeiten, weil erst ein Bruchteil bereits identifizierter alter Siedlungen erforscht sind. Es gibt hier also noch viel zu tun.
Charles C. Mann gibt in diesem Buch einen beeindruckenden Überblick über den Stand der Forschung über die Frühgeschichte Amerikas und beseitigt dabei nicht nur viele lieb gewordene Vorurteile, sondern zeigt auch, dass dieser Kontinent bereits in vorhistorischen Zeiten nicht nur bewohnt, sondern auch wesentlich weiter entwickelt war, als man bis vor kurzem gedacht hat oder sogar heute noch denkt. Dieses Buch eröffnet einen völlig neuen und außerordentlich detaillierten Blick auf die Frühzeit Amerikas.
Das Buch ist im Rowohlt-Verlag erschienen, umfasst 720 Seiten und kostet 29,95 Euro.
Frank Raudszus

No comments yet.