Bereits der Untertitel dieses Buches, „Ein Dilemma, das keines sein sollte“, verweist unfreiwillig auf den über lange Strecken vorherrschenden „Ratgeber“-CHarakter dieses Buches, Konflikte eher zu marginalisieren als sie zu strukturieren und zu analysieren. Ob das an dem beruflichen Marketing-Schwerpunkt des Autors liegt, sei dahingestellt, doch bewegt sich Brunner lange Zeit in einem „sowohl-als-auch“-Fahrwasser frei nach dem Motto „Die einen sind dafür, die anderen dagegen“.
Das trifft natürlich in den meisten Fällen – wegen der Banalität der Feststellung? – zu, und gerade deswegen vermittelt dieses Buch immer wieder den Eindruck von allseits bekanntem Gemeinwissen bis hin zum Gemeinplatz. Dass Traditionalisten die Innovation misstrauisch beäugen und Innovationsfreunde die Traditionalisten im besten Fall belächeln, ist längst Allgemeingut mittelmäßiger Kabarettisten und sollte nicht als wissenschaftliche Erkenntnis verkauft werden.
Nun mag man einwenden, der Autor stelle auch nicht den Anspruch der Wissenschaftlichkeit, doch dann stellt sich unmittelbar die Frage, für wen und weshalb er dieses Buch verfasst hat. Die als „Essay“ bezeichneten Ausführungen wären dann eher Ratgeber-Lektüre, doch ohne die praktischen Handlungstipps wie im Fall von angehenden Veganern oder Gesundheitsaposteln.
Im ersten Teil wartet Brunner zwar mit konkreten Beispielen auf, die seine Überlegungen alltagskompatibel gestalten sollen, diese beschränken sich jedoch auf so regionale wie punktuelle Gebiete wie Leberkässemmeln und bayerische Wirtshäuser. Das mag zwar manchem (süddeutschen) Leser munden, entbehrt jedoch einer gewissen intellektuellen und analytischen Tiefe.
Auch der zweite Teil, der u.a. abruptes von schleichendem Traditionssterben unterscheidet, steigt nicht zu neuen Erkenntnisgipfeln auch, sondern wandert weiterhin im flachen Tal des allgemein Bekannten. Erst am Ende dieses Kapitels entwickelt Brunner dann doch mit der Diagnose und Analyse erfundener Traditionen einige neue Gedanken, die nicht unbedingt zum Alltagswissen gehören.
Im letzten Kapitel gelingt ihm dann sogar ein gewisser Durchbruch, wenn er das Gestalten von Fortschritt und seine Versöhnung mit der Tradition an städtebaulichen Beispielen diskutiert. Seine Ausführungen über die Berliner Bauakademie oder den Potsdamer Markt sind fundiert, gut recherchiert und zeigen sowohl Probleme als auch Lösungen auf strukturierte und analytische Weise. Wenn er diese Stringenz und Tiefenschärfe schon vorher verfolgt hätte, wäre das Buch auch für eine anspruchsvolle Leserschaft ein Gewinn.
Das Buch ist im Claudius-Verlag erschienen, umfasst 159 Seiten und kostet 22 Euro.
Frank Raudszus

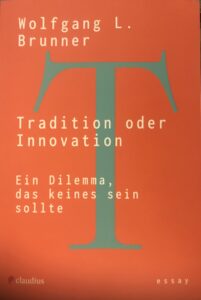
No comments yet.