Peter Handkes Protagonist geht wieder. Er verlässt das Haus und schließt das knarrende Gartentor. Das kennen wir schon. Und doch ist der neue Text „Schnee von gestern, Schnee von morgen“ anders. Es klingt wie ein Abgesang, als erwarte der Ausschreitende, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und so geht er durch die Natur, die kleinsten Phänomene wahrnehmend, aber gleichzeitig auch seinen Assoziationen und Gedanken folgend, die ihn in verschiedene Phasen seines Lebens führen oder auch allgemeine Lebenserfahrungen reflektieren.
Handke nennt sein Nachsinnen im Untertitel „Das Lautwerden des einen Kreuz- und-Quer-Gehenden zeit seines jeweiligen Innehaltens“. Aufgezeichnet hat er dieses Lautwerden „für Peter Weiß und die anderen“. Die anderen sind offenbar die Kolleginnen und Kollegen, die vor ihm gegangen sind, er ist der letzte seiner Schriftstellergeneration, der noch laut werden kann. Und das tut er hier.
Bekanntermaßen werden Handkes Texte immer kürzer, dieses Bändchen hat 74 Seiten, vom Suhrkamp Verlag allerdings schon sehr gestreckt durch großen Druck (ist offenbar für alte Leser und Leserinnen gedacht!) und breite Ränder. In normalem Druck wären es wohl höchstens 30 bis 40 Seiten. Aber das macht nichts, vielmehr fasziniert die sprachliche Verdichtung bei Handke, der mir als Leserin damit selbst viel zu tun gibt. Ich muss sehr konzentriert und langsam lesen, und das tut gut. Entschleunigung also auf Handkes Pfaden.
Das beginnt schon bei dem vorangestellten Motto von Anton Tschechow. Es sind zwei Sätze aus der Erzählung „Die Steppe“: „Die Silhouette eines Unbekannten näherte sich nachts quer über die Steppe …“ und „Zurück bei den Seinen hatte Igor ein unvermeidliches Bedürfnis, sich zu beklagen …“
So ohne Kontext sagten mir die Sätze gar nichts. Da aber bei Handke jedes Wort und jeder Satz einen Bezug hat, habe ich erst einmal die Tschechow-Erzählung gelesen. Darin geht es um die Fahrt des jungen Igor über die ukrainische Steppe, um seine intensiven Naturerlebnisse, aber auch um die Erfahrungen mit den Fuhrleuten, die ihn mitnehmen. Es werden Geschichten erzählt, die den Jungen verwirren; es gibt die Begegnung mit dem Unbekannten aus der Steppe, der allen von seinem großen Glück erzählen muss. Alle diese Eindrücke sind für den Jungen so stark, dass er am Ende der Fahrt das Bedürfnis hat sich zu beklagen. Aber er tut es nicht.
Die zwei Tschechow-Sätze umfassen das Grundthema dieses Bändchens. Zum einen ist es der Blick in die ungewisse Zukunft, die Erwartungen, was sich hinter der unscharfen Silhouette verbergen mag, also Schnee von Morgen. Auch ein alter Mensch wie der Gehende hat noch Erwartungen, ist gespannt auf das Morgen.
Zum anderen ist es der Blick zurück: Was habe ich alles gesehen, gehört, gelesen, erlebt, Schnee von gestern. Daraus mag sich das Bedürfnis zu klagen ergeben, aber Klagen ist sinnlos, eher bilanzieren und verstehen, was gewesen ist und wie es gewesen ist. Nicht hadern, sondern das gelebte Leben annehmen
Der Gehende assoziiert frei: Was ihm auf dem Weg begegnet, ruft Erinnerungen hervor, lässt über Lebensgrundsätze nachdenken, Einsichten neu erwägen, verwerfen oder doch annehmen.
Schritt für Schritt gehen wir als Leserinnen und Leser mit ihm, stets aufmerksam auf neue Hinweise, auf Verfremdungen von Bekanntem. Woher stammt das Zitat „Die große Kälte naht – oder auch nicht“? Kurz gegoogelt, es stammt von dem griechischen Dichter Dimitri T. Analis, den Handke sehr verehrt hat. Dieses Zitat ist wie ein weiteres Motto des Textes. Für den Gehenden gibt es keine Gewissheiten, alles ist möglich oder auch nicht möglich, es gibt also für das eigene Leben auch kein richtig oder falsch, es ist eben gelebt worden. Vieles, was einmal Bedeutung hatte, wird unwichtig, etwa das geplante Sammeln, stattdessen nur noch „dann und wann ein absichtsloses Aufsammeln“.
Dieser altersweise Mensch hat kein konkretes Ziel mehr. Dafür steht das Steppenmotiv aus Tschechows Erzählung. In der Weite der Steppe lässt sich ungehindert kreuz- und quergehen, es kann alles geschehen oder auch gar nichts. So geht dem Ausschreitenden alles und nichts durch den Kopf. Er spielt mit seinem großen Wissen, setzt es neu zusammen, stellt zum Teil verrückte Beziehungen her. Wie ein Jongleur spielt er mit Versatzstücken des Bildungskanons, um gleichzeitig alles in Frage zu stellen. Gerade noch wird Schillers „Geben Sie Gedankenfreiheit“ zitiert, dann Hamlets „Sein oder nicht Sein“ und „Ein Königreich für ein Pferd“ von Richard III, und dann ausgerechnet die Superschnulze „Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, schade um die Tränen in der Nacht“, wenn auch gleich wieder ironisch gebrochen durch „oder auch nicht“.
Handke führt uns mit Souveränität durch seine Gedankenwelt, immer wieder zurücknehmend, was gerade noch gelten sollte.
Eine besondere Freude hat er am Spiel mit der Sprache, wie wir es schon aus seinen früheren Texten kennen. Es scheint ihn immer noch zu begeistern, wie vielfältig Sprache ist, wie eine kleine Variation eines Ausdrucks einen ganz anderen Sinn herstellt. Was ist der Unterschied zwischen „Ich habe Zeit“, „Mir ist Zeit“ und „Mir bleibt Zeit“? Die Frage geht an die Leserinnen und Leser.
Hier ist nicht der Ort, die vielen Anspielungen und Verweise in Handkes Text darzustellen. Aber wer sich darauf einlassen mag, der wird dieses kleine Bändchen mit viel Gewinn studieren.
Es ist kein Buch zum Durchlesen, eher will es in Ruhe studiert sein wie eine Aphorismen-Sammlung, die man immer wieder zur Hand nimmt, darin blättert, mal hier eine Passage liest, mal dort. Der Text ist so dicht, so sprunghaft und assoziativ, dass jede Seite eine Herausforderung darstellt.
Der Gehende zieht wie ein Marionettenspieler die verschiedensten Bereiche des Lebens, des eigenen wie auch das der Allgemeinheit, auf die Bühne seines Textes, um sie zu betrachten, zu drehen und zu wenden und alle Seiten zu verstehen, um dann zum nächsten zu springen. Bei aller scheinbaren Zusammenhanglosigkeit zieht sich doch ein Thema durch diese Reflexionen: Wie steht es um die Natur, wie können wir die Natur angemessen wahrnehmen, was macht sie mit uns und wie gehen wir mit der Natur um? Der Geher nimmt jeden Laut wahr, der angesichts des überall vorherrschenden Lärms meist überhört wird. Wir müssen mehr hören und sehen lernen, bewusst gehen, kreuz und quer wie in der Steppe, um Eindrücke auf uns wirken zu lassen.
Wer Lust hat, sich darauf einzulassen, kann sich einfach treiben lassen und Handkes Nachsinnen, seinem Staunen, seinen Fragen folgen, um schließlich die eine oder andere Frage für sich selbst aufzugreifen und daraus einen eigenen Gedankenstrom zu machen, der vielleicht zu einer neuen Sicht auf das eigene Leben führt, mit Handke aber auch zu mehr Fragen als Antworten. Wer jedoch Klarheit und Eindeutigkeit sucht, ist bei Handke nicht richtig aufgehoben.
Bleibt noch die grundsätzliche Frage, ob es angemessen ist, in einer so krisenhaften Zeit wir der unsrigen sich auf das eigene Innenleben zu konzentrieren. Meine Antwort ist ja, insbesondere ein alter Mensch darf das tun, denn für ihn geht es auch darum, das eigene Leben zu deuten und Resümee zu ziehen.
Am Schluss lässt Handke seinen Gehenden verschwinden: „Und vorher, oder auch nachher noch, sah man ihn, wenn auch wie einen Schemen, ein ums andere Mal quer über die Steppe stolpern, aber kein Mensch kann eine Zeit sagen, wo er noch ging, und eine, wo er nicht mehr ging.“
Ist das Handkes Schwanengesang? Wer weiß!
Peter Handke, Schnee von gestern, Schnee von morgen. Suhrkamp Verlag, 74 Seiten, 20 Euro.
Elke Trost

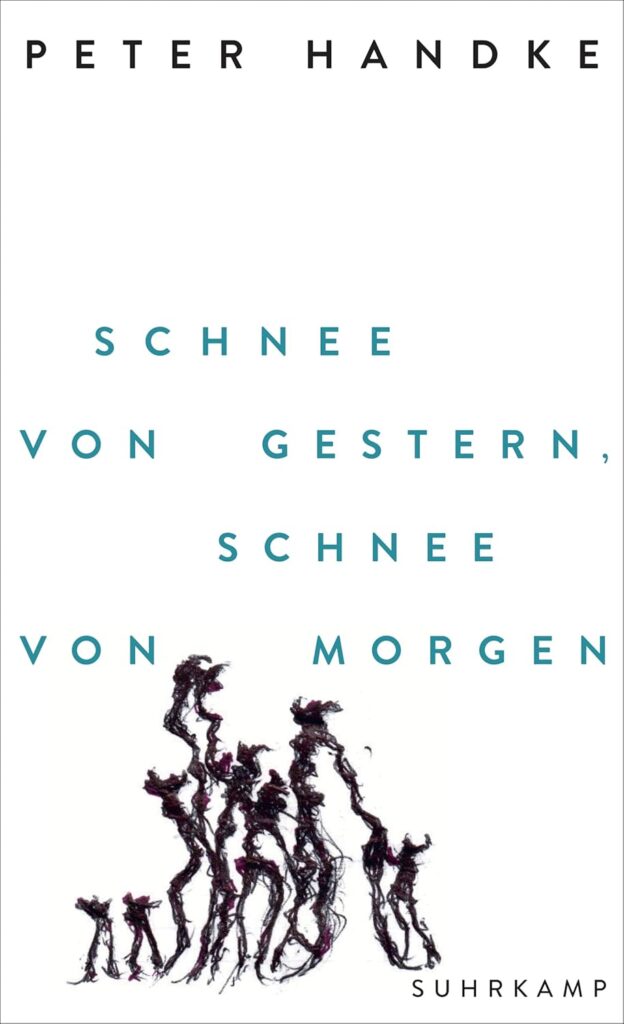
No comments yet.