Von dem Autor Ernst Weiß (1882 bis 1940) hatte ich noch nie gehört, bis sein Roman „Der Augenzeuge“ auf Platz 32 der vom Spiegel aufgeführten 100 besten deutschsprachigen Romane der letzten 100 Jahre (1924 bis 2024) rangierte (Spiegel Nr.42, 12.10.2024). Das machte mich neugierig.
Ernst Weiß war ein aus einer jüdischen Familie stammender österreichischer Schriftsteller, der in Wien und Prag Medizin studierte und später in Berlin und Wien als Chirurg arbeitete. Im ersten Weltkrieg war er Regimentsarzt an der Front in Ungarn. Nach dem Krieg lebte er als freier Schriftsteller in Berlin. Nach dem Reichstagsbrand 1933 verließ er Berlin und ging über Prag schließlich nach Paris. Als 1940 die Nazis in Paris einmarschierten, nahm er sich das Leben.
In dem Roman „Der Augenzeuge“ verarbeitet Ernst Weiß seine Erfahrungen als Arzt an der Front sowie den aufkommenden Nationalsozialismus und die Bedingungen von Flucht und Exil. Weiß schrieb den Roman im Jahre 1939. Der Roman endet mit einer für den Protagonisten hoffnungsvollen Zukunftsperspektive. Dieser Gegensatz zur verzweifelten Situation des Autors nur ein Jahr später macht besonders betroffen.
Der Ich-Erzähler, der Protagonist des Romans, hat offenbar ähnliche Lebensdaten wie der Autor, auch er wird Arzt und erlebt den 1. Weltkrieg an der Front als Militärarzt wie auch als Frontkämpfer, auch er wird ins Exil in die Schweiz und schließlich nach Paris gehen.
Aber es geht Weiß nicht um die Darstellung seiner eigenen Lebensgeschichte. Das zeigt sich schon daran, dass sein Protagonist nicht jüdisch ist. Vielmehr geht es um die lebensgeschichtlichen- wie zeitgeschichtlichen Entwicklungen, die dessen Leben prägen.
Ein sich durchziehendes Thema ist das Bedürfnis nach Macht über andere Menschen, sowohl im persönlichen Bereich als auch im politischen Bereich.
Der Protagonist wächst in gutbürgerlichen Verhältnissen in Süddeutschland auf, die Mutter ist stockkatholisch und latent antisemitisch, der Vater als Ingenieur eher liberal. Als Folge einer übermütigen Selbstüberschätzung wird er als Junge von einem Pferd getreten und schwer verletzt. Die Folgen dieser Verletzung werden ihn ein Leben lang begleiten. Es ist seine erste Erfahrung von Hochmut und tiefem Fall. Sie lehrt ihn jedoch Selbstkontrolle und Beherrschung auch in schwierigen Situation. Dieses Ereignis legt den Grundstein für seine Haltung als Augenzeuge, das heißt der genauen Beobachtung und Protokollierung von Ereignissen – oder auch als Arzt von Krankheitssymptomen -, ohne sich die Rolle des Richters anzumaßen.
Eine zweite einschneidende Erfahrung ist der wirtschaftliche und gesellschaftliche Abstieg des Vaters nach einem vom Vater als leitendem Ingenieur zu verantwortendem Brückeneinsturz. Ein Studium ist nur möglich durch das Stipendium, das ihm ein Onkel gewährt. Dass der Student den größten Teil davon seinen Eltern sowie der „Zweitfamilie“ des Vaters gibt, nehmen die Eltern als selbstverständlich an.
Der Protagonist schlägt sich durch als Tellerwäscher, bald aber auch als Assistent eines bekannten Psychiaters, der die Gehirnforschung voranbringen will. Hier lernt der angehende Psychiater und Chirurg, wie man etwa über die Hypnose Macht über Menschen erringen kann. Er entscheidet sich jedoch schon früh, die Moral nicht der Wissenschaft unterzuordnen und stattdessen etwa dafür zu kämpfen, dass bei Tierversuchen die Vivisektion abgeschafft wird.
Den Beginn des 1. Weltkriegs kommentiert der Erzähler mit Worten, die uns gerade heute in unserer politischen Situation unter die Haut gehen müssen: „Mit einem Schlage gab es kein Europa mehr, die Grenzen waren gesperrt, und überall floß Blut. (…) Der Kosmopolitismus war zu Ende. (…) Es herrschte Kriegsrecht, Notrecht, also kein Recht.“
Seine Erfahrungen als Arzt im 1. Weltkrieg machen ihm die Absurdität seiner Arbeit bewusst: Er soll junge Soldaten zusammenflicken, damit sie wieder als Kanonenfutter dienen können. Die an der Front nicht mehr einsatzfähig sind, arbeiten im Hinterland, dafür müssen neue Kräfte als Kanonenfutter dienen. Die Verzweiflung treibt ihn selbst an die Front, wo er verletzt wird und schließlich wieder als Arzt in einer psychiatrischen Klinik in Norddeutschland eingesetzt wird.
Hier trifft er auf die seelischen und geistigen „Kriegsruinen“. Diese Episode enthält eine der faszinierendsten Passagen in dem Roman. Unter den Patienten befindet sich der österreichische Gefreite H., der an hysterischer Blindheit leidet. Er wiegelt seine Mitpatienten durch radikale politische Sprüche und Reden auf, er verkündet unverhohlenen Judenhass. Dennoch interessiert sich der junge Arzt besonders für diesen Patienten, denn er glaubt an seine Macht, diesen mit den Mitteln Hypnose von seiner Blindheit und seiner Schlaflosigkeit zu heilen. Es ist spannend zu lesen, wie ihm das gelingt. Damit geht ein fundiertes Psychogramm H.s einher, offenbar auf der Grundlage psychoanalytischer Annahmen. Der Erzähler spricht von der Herausarbeitung der „Unterseele“, gemeint ist das Unbewusste.
Diese Begegnung wird jedoch Folgen haben, denn er behält die wichtigsten Protokolle zu diesem Fall. Das wird ihm später nach der Machtergreifung zum Verhängnis werden und sein ganzes weiteres Leben beeinflussen.
Sein Leben verläuft nach dem Krieg zunächst in gutbürgerlichen Bahnen. Er heiratet seine große Liebe, die Tochter des alten jüdischen Hausarztes, hat zwei Kinder, ist im Beruf erfolgreich. Gleichzeitig aber erlebt er die Bedrohung durch den Aufstieg des Nationalsozialisten und des ehemaligen Gefreiten H. und die Schwäche der Weimarer Republik. Wie verführbar die Menschen durch Propaganda, durch große Worte, durch Lügen und Hassparolen sind, erlebt der Erzähler, als er an einer Großveranstaltung teilnimmt, auf der H. redet. Er fühlt, wie er selbst in der Masse aufzugehen droht, seine lang eingeübte Rolle als neutraler „Augenzeuge“ aufzugeben droht. Erst draußen findet er wieder zu sich und entschließt sich, selbst für die demokratischen Kräfte aktiv zu werden. Weiß hat hier sicher die Rede Hitlers am 11. Januar 1923 vor 8000 Zuhörern im Zirkus Krone vor Augen. Man möchte am liebsten den Bezug zur Gegenwart verdrängen!
Der Erzähler gerät schließlich ins Visier der Nazischergen, er wird gewarnt und kann rechtzeitig in die Schweiz entkommen, auch seine jüdische Frau schafft es in die Schweiz. Doch das Regime lässt nicht locker, mit einem gefälschten Telegramm wird er zurück ins Reich gelockt, verhaftet, gefoltert, kann aber schließlich auf ominöse Weise entkommen. Zwar physisch gerettet, steht ihm doch ein Leben im Exil bevor, das ihn psychisch an den Rand seiner Kräfte bringt. Er darf in Frankreich nicht als Arzt arbeiten, und die eheliche Beziehung ist zunehmend von Missverständnissen und gegenseitigem Misstrauen geprägt. Er sieht nur die Alternative Selbstmord oder Einsatz im spanischen Bürgerkrieg. Er will etwas tun, nicht nur Augenzeuge sein, deshalb erscheint ihm der Kampf für die Republik eine Perspektive, die ihm noch Zukunftshoffnung erlaubt.
Weiß zeigt in diesem Roman die schleichende Indoktrination der Bevölkerung, die bis in die Familien hinein Beziehungen vergiftet oder gar zerstört, ebenso die Naivität des Generalstabs, der sich von H. die Rückkehr zum Kaiserreich erhofft, und die zunehmende Schwäche der Weimarer Republik. Schon 1939 erkennt Weiß sehr genau die Instrumentalisierung des Vertrags von Versailles sowie die Diskreditierung der deutschen Unterhändler beim Waffenstillstand vom 11.11.1918 als „Novemberverbrecher“, die der systematischen Verleumdung der Demokratie dient.
Dabei ist Weiß ein sehr poetischer Schriftsteller, der mit genauem psychologischem Blick des Protagonisten seine Figuren analysiert. Auch er selbst ist dabei nicht der „Richter“, sondern der „Augenzeuge“, der zu verstehen versucht, ohne zu urteilen, allerdings nur so lange, bis es nicht mehr geht.
Diesen Roman gerade jetzt zu lesen, rüttelt auf und mahnt, die warnenden Signale nicht zu übersehen und alles zu tun, um die Demokratie zu verteidigen.
„Der Augenzeuge“ ist ein Roman, den ich dringend allen Leserinnen und Lesern ans Herz lege.
Ernst Weiß, Der Augenzeuge. Suhrkamp Verlag, 297 Seiten, Taschenbuch, 22 Euro.
Elke Trost

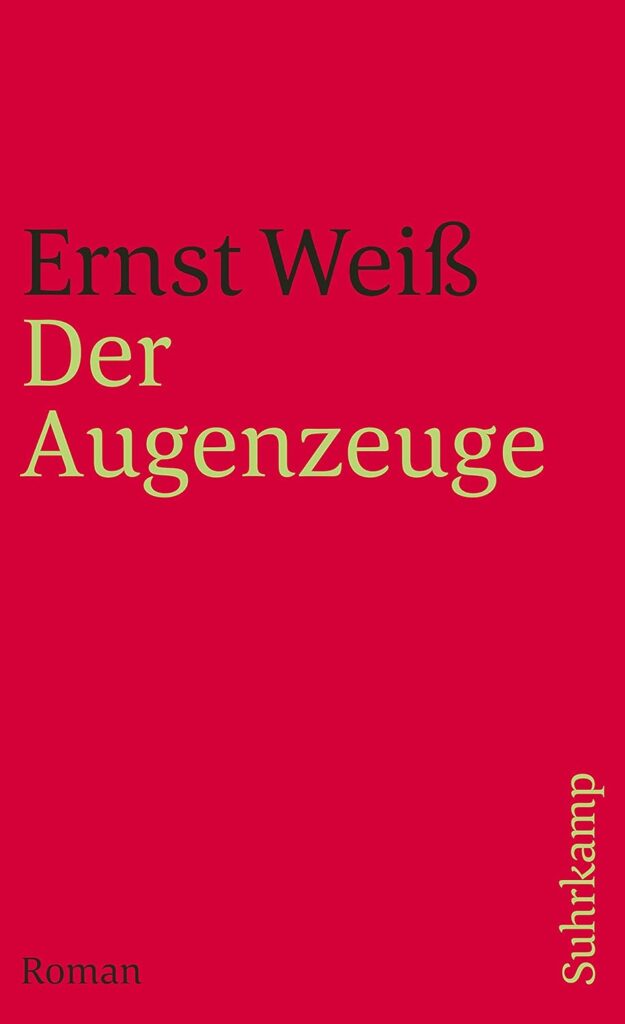
No comments yet.