Die 1944 geborene Schriftstellerin Elfi Conrad veröffentlichte ihre ersten Romane 2018 und 2019 unter dem Pseudonym Phil Maria. 2023 erschien der Roman „Schneeflocken wie Feuer“ als erster unter ihrem bürgerlichen Namen. Jetzt hat die mittlerweile 80-jährige einen weiteren Roman geschrieben, in dem sie die Fluchtgeschichte ihrer Mutter und ihrer Großmutter verarbeitet.
Die Familie stammt aus dem Städtchen Trebnitz (heute Trebnica) in Niederschlesien, nördlich von Wracław (ehemals Breslau). In Trebnitz haben die Eltern eine Drogerie, sie gehören zu den im Dorf anerkannten Familien. Als im Januar 1945 die Rote Armee näher rückt, fliehen die Frauen der Familie ins von den Deutschen besetzte „Protektorat Böhmen und Mähren“. Es sind Margarete (Anfang 40) und ihre Töchter Ursula (22) und Kathi (15). Ursula hat den drei Wochen alten Säugling Dora dabei. Die Männer sind an der Front.
Margarete hat den ersten Weltkrieg als Zwölfjährige schon bewusst miterlebt. Sie hat als mittleres von neun Kindern wenig Mutterliebe erfahren, war deshalb dankbar für das „Liebesangebot“ des Onkels. Nach dem Krieg ergeben sich neue Perspektiven für eine junge Frau. Als Schneiderin will sie eine selbständige Existenz aufbauen. Das aber wird ihr verwehrt, stattdessen wird sie verheiratet und muss sich damit der traditionellen Frauenrolle unterwerfen. Jetzt im Flüchtlingslager ist sie in großer Sorge um die Töchter.
Ursula ist durch und durch von der nationalsozialistischen Erziehung geprägt und glaubt noch lange an den Führer und den von ihm versprochenen Endsieg, während die jüngere Schwester schon längst das Lügengebäude durchschaut hat.
Die drei Frauen müssen sich mit den Bedingungen im Flüchtlingslager arrangieren. Hier gilt nichts mehr von der Gut-Bürgerlichkeit ihrer früheren Existenz, es geht vielmehr darum, das Nötigste für sich und den Säugling zu ergattern. Erst jetzt beginnt Ursula „ihre verbrecherische Liebe einem Verbrecher gegenüber“ zu hinterfragen. Sie fühlt sich für das Überleben des Säuglings, ihrer Mutter und ihrer Schwester verantwortlich. Nach der ersten Wut über ihre neue Situation wandelt sie sich „von einer Rebellin zu einer Dressierten“. Im Lager gelten in erster Linie Zigaretten als Währung mit Kaufkraft. Dafür setzt sie ihre Schönheit und Attraktivität ein, das bedeutet eine Gratwanderung zwischen unverbindlichem Flirt und Sich-Verkaufen.
Die Erfahrungen mit der tschechischen Bevölkerung sind ambivalent. Die Flüchtlinge erfahren die Wut und Rachsucht der von den Deutschen unterdrückten Tschechen, aber auch Mitleid und Hilfsbereitschaft. Ursula gelingt es mit dem Einsatz ihrer Weiblichkeit, ihre Familie und insbesondere den Säugling über Wasser zu halten. Schließlich ergattert sie sogar Fahrkarten aus dem „Protektorat“ nach Bayern.
Diese Fahrt ist eine neue Fluchterfahrung mit ständiger Unsicherheit, ob ein Zug überhaupt kommt, ob Platz ist, ob er bis Deutschland fährt. Dazu kommen Kälte und Mangel am Nötigsten.
In Deutschland müssen sie erfahren, dass sie keineswegs willkommen sind und abweisende Reaktionen der Einheimischen hinnehmen müssen, ganz anders, als sie es mit vielen Tschechen erlebt haben. Erst als sie es zu Verwandten in den Harz schaffen, gibt es Hoffnung auf ein neues Leben.
Elfi Conrad erzählt in einer knappen, aber sehr eindringlichen Sprache die Erfahrungen der drei Frauen abwechselnd aus deren jeweiliger Perspektive. Das geschieht mit der Distanz der personalen Erzählhaltung in der dritten Person. Dadurch werden die Kriegs- und Fluchterfahrungen der drei Frauen auf eine objektive Ebene gehoben, auf der es um die Erfahrungen des Flüchtlingslebens schlechthin geht, nicht um das Mitleid mit diesen drei Frauen.
Elfi Conrad gelingt es meisterhaft, die Schuld der Deutschen auch angesichts des Leids nach dem Krieg immer transparent zu machen. So kann die 15-jährige Kathi nicht vergessen, dass ihre beste Freundin eines Tages plötzlich verschwand. So jung sie ist, spürt sie doch, dass das Schweigen der Mitbürger falsch ist. Sie durchschaut das „Sich-Ducken der Eltern“ und die „Schwärmerei der großen Schwester für den Nazistaat“.
Auch Ursula erkennt schließlich, dass die Versprechungen falsch waren. Allein die Hoffnung auf eine neues Frauenbild wird von den Nazis enttäuscht. Sie hat das beste Abitur an einem Jungengymnasium gemacht, wird aber als Frau von den Nazis nur als „Gebärmutter“ gesehen.
Die Perspektive des Säuglings ist in die Zukunft gerichtet. Es ist, als kenne die kleine Dora ihre Zukunft, als könne sie sehen, wie ihre beschädigte Familie ihr Leben prägen wird. Aber trotz aller Not und Entbehrungen hat sie im ersten Lebensjahr die Liebe und Zärtlichkeit ihrer Mutter erfahren und dadurch Lebenskraft gewonnen, die sie später als junges Mädchen befähigen wird, ihre zerrüttete Familie zusammenzuhalten. Das haben wir als Leserinnen bereits in dem Roman „Schneeflocken wie Feuer“ erfahren. „Als sei alles leicht“ liefert nun die Vorgeschichte dazu.
Elfi Conrads Figuren vermitteln, was es heißt, mit dem Zusammenbruch eines Systems zu leben. Es bedeutet nicht nur den Verlust der Heimat und die Erfahrung von Ablehnung und Zurückweisung, sondern auch das „Umlernen“ aller bisher gültigen Werte und deren sprachlichen Ausdrucks. Hier ist es insbesondere Ursula, die sich über ihre Indoktrinierung als junges Mädchen beim BDM klar werden muss, die lernen muss, dass bestimmte Wörter nicht mehr gelten, dass ein Wort wie „Rassenschande“ Ausdruck brutaler Menschenverachtung ist, damit zu einem Unwort wird.
Elfi Conrads Roman kommt gerade richtig in einer Zeit, in der viele von uns vergessen zu haben scheinen, wie viele unserer Eltern und Großeltern Flüchtlinge waren. Damals waren sie die „Ausgestoßenen und die anderen die, die nichts mit ihnen zu tun haben“ wollten“, sie erfuhren, dass das „Wort Flüchtling … einen bösen Klang (hat). Es klingt nach Untermensch, Asozialer, Fremdrassiger“.
Nicht Mitleid will Elfi Conrad für das Leiden der Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg, vielmehr plädiert sie mit ihrem Roman für Toleranz und Großherzigkeit mit Menschen, die vor Krieg und Hunger geflohen sind. Auch wenn wir nun von „Geflüchteten“ statt von „Flüchtlingen“ sprechen, sind in unseren Köpfen die alten Vorbehalte immer noch existent.
Leider leisten die entsetzlichen Taten Einzelner diesen alten Denkmustern Vorschub. Dagegen steht das Buch von Elfi Conrad. Schon deshalb ist ihr Roman unbedingt empfehlenswert.
Elfi Conrad, Als sei alles leicht. Verlag mikrotext, 120 Seiten, 22 Euro.
Elke Trost

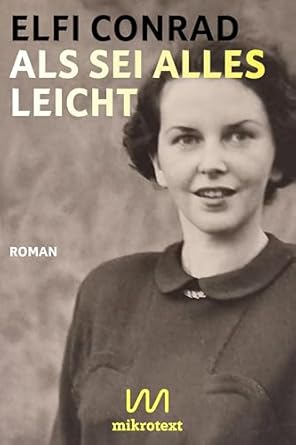
No comments yet.