Der Debütroman „Aus dem Haus“ von Miriam Böttger hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Sie, bzw. die Erzählerin, schildert die Schwierigkeiten ihrer Eltern, mit ihrem Leben zurechtzukommen, und deren Unfähigkeit, zufrieden, geschweige denn, glücklich zu sein.
Aus der Sicht der erwachsenen Tochter erscheinen die Eltern eher wie stets nörgelnde Kinder, die nie mit dem zufrieden sind, was sie haben, und sich immer nach dem anderen sehnen. Meine Irritation bezieht sich auf den Erzählton: Macht sich hier eine Tochter aus einem Überlegenheitsgefühl über ihre Eltern lustig, oder ist es eher eine Liebeserklärung an die Eltern, denen sie mehr Glück gewünscht hätte? Über lange Strecken des Romans schien mir der Spott im Vordergrund zu stehen. Vieles klingt für mich nach Besserwisserei der Jüngeren, die doch aber, wie alle Kinder, die Eltern nur von außen und in einem begrenztem Zeitraum sieht. Kinder kennen ihre Eltern nicht als junge Menschen, und sie haben keinen tiefen Einblick in deren eheliche Beziehung.
Gegen Ende überwog für mich die liebevolle Darstellung dieser beiden Menschen, um deren Wohlergehen die längst flügge gewordene Tochter stets besorgt ist.
Was wird erzählt?
Die Eltern sind nach einer als glücklich erinnerten Zeit in Weinheim an der Bergstraße aus beruflichen Gründen nach Kassel, dem Geburtsort der Mutter, zurückgekehrt. Und damit beginnt das ganze Elend. Die Mutter, die „Hohepriesterin des Unglücklichseins“, empfindet Kassel als den Ort des Spießertum schlechthin, als Ort, der die nordische Schwere des Lebens symbolisiert, während Weinheim für südliche Leichtigkeit und Weltläufigkeit stand. In dieser neuen Welt versucht sie sich mit extravagantem, anti-spießigem Lebensstil abzugrenzen. Designer-Kleidung, Designer-Möbel und teure Autos geben den Anschein von Exklusivität, führen jedoch eher zu Vereinsamung in der neuen Umwelt. Symbolisch für diese neue Lebenswelt ist das riesige HAUS, das die Eltern auf einem Grundstück der Großmutter bauen. Der Anspruch auf Weltläufigkeit wird aber durch die Lage hinter einem Mietshaus der Großmutter konterkariert. Eigentlich ist alles falsch an diesem HAUS, die Mutter empfindet es trotz seiner Größe eher als Gefängnis. Lust und Lebensfreude wollen hier nicht aufkommen. Der Vater ist beruflich sehr eingespannt, bald auch nicht mehr in Kassel tätig, sondern Wochenendpendler von einem neuen Einsatzort. Den depressiven Verstimmungen seiner Frau kann er als deren stets williger „Gehilfe“ nichts entgegensetzen. Das HAUS ist in den Augen der Mutter eben der Urgrund allen Unglücks
Der eigentliche Kampf der Mutter ist der gegen die Zeit und den Verfall. Sie tut alles, um jugendlich frisch zu wirken, solange es irgendwie geht. Auch das aber dient nicht einer größeren Attraktivität als mögliche Freundin, vielmehr als Mittel, sich von den spießigen Kasselerinnen abzusetzen. Sie genießt den Auftritt, wenn man sich nach ihr umdreht. Aber mehr ist es auch nicht. Immer wieder zieht sie sich in depressive Verstimmungen zurück und kommt dann tagelang nicht aus dem Bett.
Die erwachsen werdende Tochter analysiert das alles sehr genau. Dennoch kommt sie als Studentin sehr regelmäßig nach Hause, ist immer noch Teil dieses Systems Familie, dem sie sich trotz aller analytischen Distanz zugehörig fühlt.
Sie geriert sich als wissende Ratgeberin für die aus ihrer Sicht oft hilflosen Eltern. So kommt es zum Beispiel zu einer komisch-grotesken Szene, als die Eltern ausnahmsweise einmal Besuch erwarten. Natürlich kommt man nur wegen der Documenta alle 5 Jahre nach Kassel, da passt der Besuch bei ehemaligen Freunden. Die wissende Tochter empfiehlt als Beköstigung Berliner Life-Style-Food, was völlig in die Hose geht.
Der entscheidende Impuls für ein entspannteres Leben kommt wiederum von der Tochter: Sie drängt die Eltern, das HAUS zu verkaufen, Ballast abzuwerfen und sich zu verkleinern. Der gegenteilige Effekt entsteht. Als das HAUS endlich verkauft ist, wollen Vater und Mutter eigentlich gar nicht mehr ausziehen. Alles, was bisher negativ war, wird jetzt ins Positive gekehrt. Entsprechend schieben die Eltern das Ausräumen des Hauses vor sich her. Miriam Böttger beschreibt diesen langen Trennungsprozess mit viel – liebevoller??? – Ironie: Wie die Eltern zunächst wie gelähmt sind und einfach gar nichts tun; wie der Vater, ein leidenschaftlicher Sammler, versucht sein Kellerarchiv zu räumen und umzulagern, dabei aber oft einmal hinausgetragene Gegenstände wieder in das HAUS hineinträgt; wie die Mutter in einem hysterischen Anfall alles aus dem Fenster wirft und der Vater davon zu retten versucht, was zu retten ist.
Zum Erstaunen der Tochter gelingt schließlich der Auszug aus dem nun plötzlich geliebten HAUS in ein neues „Elend“, in die „Gummizelle“ von 100 Quadratmetern, die nach dem 300-Quadratmeter-Haus ein neues Gefängnis wird. Hier werden die Eltern nicht lange bleiben, sondern zur Tochter nach Berlin ziehen. Ob sie da nun glücklicher sind, ist die Frage, denn sie streiten sich als Mitte 70-Jährige, kurz vor dem Tod des Vaters, so sehr, dass die fürsorgliche Tochter darüber nachdenkt, ob man die beiden nicht doch noch trennen müsste.
Der kleine Roman ist von einem eigentümlichen Reiz. Zeitweise habe ich die Erzählung der Tochter geradezu als Altersdiskriminierung gelesen, um mich dann während des Lesens gleich wieder zu korrigieren. Denn eher nimmt die Erzählerin sich als Tochter selber aufs Korn, die sich als diejenige empfindet, die alles besser weiß und glaubt, ihre Eltern vor sich selber beschützen zu müssen. Umso verwunderter ist sie, wenn sie ihre Eltern von Zeit zu Zeit vertrauensvoll Hand in Hand gehen sieht. Wer versteht denn mehr von einem langen Eheleben und von der Dynamik einer Beziehung? Mit Sicherheit nicht die Tochter. Muss es ihr doch erst einmal besser gelingen. Diese Eltern haben bei scheinbarer äußerer Unabhängigkeit in dem großen Haus, in dem die Trennung der Lebenssphären sich gut einrichten ließ, offenbar doch ihre besondere Form von Zweisamkeit gefunden. Sie weiß, dass sie sich jederzeit ausklinken darf, er weiß, dass er sich in sein „Archiv“ verkriechen darf, so oft ihm danach ist. Was aus der Sicht der Tochter unerträglich ist, ist für die Eltern eine ihnen gemäße Lebensform geworden. Für die Mutter gehört das Klagen dazu.
Irgendwann erkennt die Tochter, dass die Mutter ihr ganzes Leben gegen die Zeit und die Vergänglichkeit anzukämpfen versucht. In diesem Sinne ist der Roman auch ein Zeitroman und ein Generationenroman. Die junge Generation wird die Elterngeneration nie ganz verstehen können, weil sie deren lebensgeschichtlichen Bezugsgrößen nicht kennt. Dieses Thema entfaltet Miriam Böttger mit viel Einfühlung. Hinzu kommen erfreuliche sprachliche Präzision und stilistische Sicherheit.
Insgesamt ist das ein „Familienroman“ der anderen Art, der uns als Leserinnen und Leser immer wieder auffordert, aus konventionellen Denkmustern auszubrechen.
Der Roman ist im Galiani Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 23 Euro.
Elke Trost

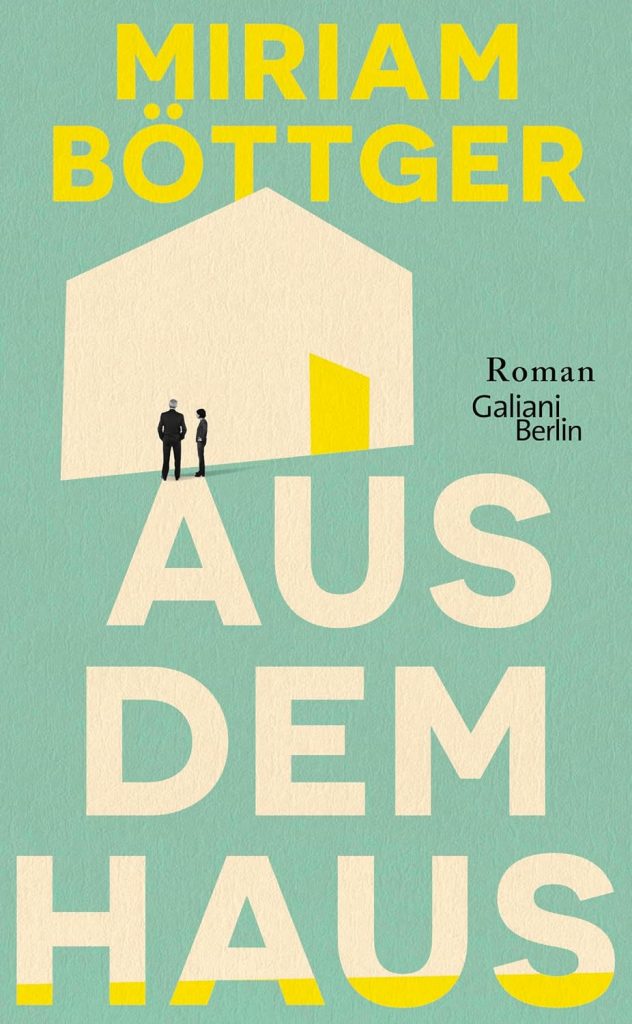
No comments yet.