Nach seinem Buch über „Mozart und die Aufklärung“ hat der Schweizer Musiktheoretiker Laurenz Lütteken nun ein Buch veröffentlicht, dessen Inhalt in dem oben genannten Werk explizit nicht im Vordergrund stand und dessen Titel „Die Zauberflöte“ gleichzeitig selbsterklärend und programmatisch ist. Schließlich ist diese Oper das weltweit meistgespielte Stück dieser Gattung, trotz ihrer Schwächen oder, besser gesagt, ihrer Merkwürdigkeiten, die Lütteken in diesem Buch systematisch aufs Korn nimmt. Der Untertitel „Mozart und der Abschied von der Aufklärung“ setzt dabei bereits die Randbedingungen und dient gleichzeitig als Verweis auf und als Abgrenzung von dem oben erwähnten Buch.
In Musikerkreisen gilt es als weitgehend unbestrittene Tatsache, dass die „Zauberflöte“ die Rettung eines desaströsen – Schikaneders! – Librettos durch eine geniale – Mozarts! – Musik ist. Lütteken bestreitet das im Grunde genommen nicht, deutet diese Eigenarten des Librettos – und auch die der Musik! – jedoch auf ganz eigene Weise.
Eine gängige Interpretation läuft darauf hinaus, dass Mozart aus finanzieller Not darauf angewiesen war, Schikaneders indiskutables Libretto zu vertonen. Dem widerspricht Lütteken mit der mittlerweile unbestrittenen Erkenntnis, dass Mozarts finanzielle Probleme nicht auf Erfolglosigkeit, sondern lediglich auf seine verschwenderische Lebensführung zurückzuführen und daher durch Disziplin zu lösen waren.
Doch das reicht Lütteken nicht. Aus der Verwendung des Begriffs „Metier“ für die eigene Tätigkeit in Mozarts Korrespondenz schließt er, dass Mozart sich mehr als Unternehmer denn als freischaffender Künstler sah und schon deshalb kaum naiv in den Bankrott gerutscht sein dürfte. Darüber hinaus weist er anhand der Korrespondenz mit Schikaneder über die „Zauberflöte“ nach, dass Mozart, wie auch bei den anderen Opern davor, eindeutig und erfolgreich Einfluss auf das Libretto nahm, ja: dieses im Grunde genommen weitgehend selbst gestaltete. Gerade die Ähnlichkeiten mit anderen Opernprojekten zeigen laut Lütteken, dass Mozart von Anfang an einen klaren Plan bezüglich Libretto und Musik hatte und keinesfalls als bloß musikalischer Dienstleister in dieses Projekt stolperte.
Auch das Vorstadt-Theater, in dem die Uraufführung der „Zauberflöte“ stattfand, war entgegen weit verbreiteter Annahmen keineswegs ein Etablissement für die Armen und Dummen, sondern bewegte sich, wie Lütteken unter anderem anhand der Preislisten nachweist, durchaus auf dem Niveau der „gehobenen“ Theater und wurde auch von deren Publikum frequentiert.
Doch auch das reicht Lütteken noch nicht. Systematisch geht er alle Aspekte einer Operninszenierung am Beispiel der „Zauberflöte“ durch. So sieht er schon beim Bühnenbild eine Mischung aus natürlichen und künstlichen Elementen. Da die „Natur“ damals bei vielen Opern eine große Rolle hinsichtlich ihrer Unverfälschtheit spielte, fallen hier die Tempel und andere künstliche Teile besonders auf. Ähnliche Effekte konstatiert Lütteken bei anderen Szenen, wo Natur und Ratio ineinander verwoben sind.
Ähnliches entdeckt er bei den Handlungsabläufen, was zwar nicht neu ist, aber hier analysiert und nicht belächelt wird. So weist er darauf hin, dass gleich in der ersten Szene der „Held“ Tamino mit einem Bogen – ohne Pfeil! – vor einer einfachen Schlange flieht und in Ohnmacht fällt, während die drei Damen die Schlange verscheuchen. Weiterhin tritt die „Königin der Nacht“ erst als Paminas liebende Mutter auf, um dann plötzlich zur machtbesessenen Rachegöttin zu mutieren. Auf der anderen Seite präsentiert sich Sarastro als weiser Priester einer erhabenen Sekte – Freimaurer? -, nur um dann seine Sklaven (sic!) für mittlere Vergehen brutal zu bestrafen. Dann stehen wiederum die feierlichen, todernsten Auftritte Sarastros und seiner Priester in direktem Kontrast zu den volkstümlichen, geradezu albernen Strophenliedern Papagenos.
Neben diesen irrationalen Kontrasten der Handlung stehen ikonische Begriffe im Mittelpunkt. Die angeblich lebensgefährliche Prüfung, die Tamino und Pamina durchlaufen müssen, findet keinerlei rationale Begründung und verharrt geradezu im Mythischen, und auch der Verweis auf Mozarts Zugehörigkeit zu den Freimaurern scheitert an der nie mit tödlichen Gefahren verbundenen Aufnahmeritualen dieses Ordens.
Diese Ambivalenz des Librettos setzt sich auch in der Musik fort. Die Opernregeln der Aufklärung, und das gilt auch für Mozarts frühere Opern, verlangten nicht nur „Wahrheit und Wahrscheinlichkeit“, sondern auch eine strukturierte Hierarchie der Musik. Dazu gehörte nicht nur eine glaubwürdige musikalische Überleitung zwischen verschiedenen emotionalen Situationen, sondern auch die bewusste Steigerung der musikalischen Mittel zum Finale eines jeden Aktes im Sinne der Überwältigung des Publikums. Die „Zauberflöte“ jedoch besteht aus zweiundzwanzig sequentiell angeordneten „Stücken“ ohne Hierarchie und Überleitungen, deren Kontraste an den Grenzen schroff aufeinander prallen.
Natürlich geht Lütteken auch auf die Details der Musik ein, bis hin zu Notenbeispielen ausgewählter Passagen, die mit Vorbildern oder Vorläufern der Epoche verglichen werden. Da sieht man bestimmte Nachahmungen, die jedoch nicht als Plagiate sondern nur als Zitate mit eigenen Abwandlungen zu verstehen sind. Die entsprechenden Ausflüge in die Musiktheorie sind ein Thema für sich und lohnen alleine die Lektüre, doch Lütteken beleuchtet auch die möglichen Beweggründe Mozarts für die jeweilige Wahl und Ausgestaltung eines Themas.
Nach der ausführlichen Diagnose dieses inhaltlich wie musikalisch ambivalenten Werkes kommt Lütteken schließlich auch zu einer Erklärung, ohne die diese so tief schürfende Analyse nur eine veredelte Form der üblichen Rezeption wäre. Kaiser Joseph II. hatte Anfang der 1780er Jahre – ganz im Sinne der Aufklärung – eine gewaltige Reformlawine losgetreten, die sich jedoch schnell verselbständigte und ideologische Formen annahm. Als Leser denkt man sofort an die heutige „Cancel Culture“, die ursprünglich aus der Forderung nach Achtsamkeit und Partizipation entstand. So hatte sich bis zum Ende dieser Dekade eine äußerst labile gesellschaftliche Situation zwischen radikaler Rationalität und reflexhafter Flucht ins Mythische entwickelt, die alle Lebensbereiche und besonders die Kunst in Mitleidenschaft zog. Lütteken sieht in der „Zauberflöte“ die Abbildung dieser Situation im künstlerischen, hier: musikalischen Werk. Ihm zufolge hat Mozart den aktuellen Zeitgeist der frühen 1790er Jahre in dieser Oper gespiegelt, ohne dass er noch die Gelegenheit gehabt hätte, sich näher dazu zu erklären, denn zwei Monate später war er tot. Außerdem kann man mit Fug und Recht annehmen, dass Mozart weniger der Intellektuelle mit großer rhetorischer Begabung als vielmehr ein begnadeter Musiker mit einem feinen Gefühl für gesellschaftliche Befindlichkeiten war. Und letztere haben dann laut Lütteken ihren Niederschlag in der „Zauberflöte“ gefunden. Der große Erfolg bei allen gesellschaftlichen Schichten von der ersten Aufführung an lässt sich dann darauf zurückführen, dass die „Zauberflöte“ den Nerv der Zeit traf, auch wenn das vielen vielleicht nicht in dem Maße bewusst war.
Dieses Buch ist eine Fundgrube für jeden Musikliebhaber, nicht nur für Opernfreunde, und selbst verständliche Einwände gegen die eine oder andere Hypothese werden kaum die Bedeutung und die Aussagekraft der Ausführungen mindern können.
Das Buch ist im Verlag C. H. Beck erschienen, umfasst 272 Seiten und kostet 28 Euro.
Frank Raudszus

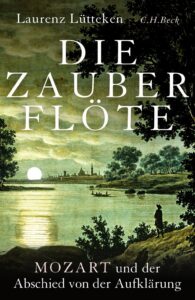
No comments yet.