In ihrem Buch „Generation Krokodilstränen – Über die Machttechniken der Wokeness“ setzt sich Pauline Voss kritisch mit der Bewegung der Wokeness auseinander, deren Protagonisten sie als selbst ernannte sprachliche Sittenwächter sieht, die die freie, argumentative gesellschaftliche Diskussion kontroverser Themen bedrohen.
Ausgehend vom Diskursbegriff Foucaults analysiert sie in genauer Recherche die zunehmend moralisierende Zensur sprachlicher Muster, die von den Vertretern einer neuen „Wokeness-Kultur“ als diskriminierend, sexistisch, rassistisch oder politisch unkorrekt bezeichnet werden. Der analytische Bezug ist Foucaults These, dass hinter jedem Sprechakt ein Machtanspruch stehe, den es jeweils zu entlarven gelte. Den immanenten Widerspruch seines diskurskritischen Ansatzes erkennt Foucault durchaus, insofern auch der entlarvende Sprechakt, der von Beherrschung befreien will, wiederum ein Akt mit Machtanspruch ist, der für sich die Wahrheit beansprucht. Es gehe deshalb darum zu definieren, wie legitime Machtausübung sich darstellen könne. Die Antwort bleibe Foucault jedoch schuldig.
Voss geht von diesem Widerspruch aus, um aufzuzeigen, wie sich die Vertreter der Wokeness-Bewegung als Befreier von Diskriminierung verstehen, ohne zu erkennen, dass sie das mit der Unfreiheit der – von ihnen aus gesehen – Diskriminierenden erkaufen. Adorno nannte das „Dialektik der Aufklärung“, eben den Umschlag von Befreiung in neue Herrschaft.
Wokeness gehe von der Diskriminierungshypothese aus, die an den verschiedensten gesellschaftlichen Orten rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung vermutet, die sich in der Sprache manifestiert, oft ohne dass das den Sprechenden bewusst werde. So würden zunehmend Sprachcodes entwickelt, die zwischen erlaubten und unerlaubten Wörtern strikt unterscheiden. Wem diese Codes nicht bekannt seien und wer sich öffentlich mit seinen Worten vertue, der sei unter Umständen einer öffentlichen moralischen Verurteilung ausgesetzt, die ihn oder sie nun seinerseits bzw. ihrerseits bloßstelle und bisweilen sogar sozial vernichte. Diese neue Macht der „Shitstorms“ trete auf unter dem Anspruch der Befreiung der Unterdrückten. Voss bezeichnet die radikalen Protagonisten der Wokeness als Sprachwächter, die von moralischer Zensur nicht weit entfernt seien.
Voss nennt einige Beispiele, die in ihren – und auch in meinen – Augen kaum noch nachvollziehbar sind. So musste sich in Großbritannien der Schauspieler Benedict Cumberbatch mit einer Unterwerfungsgeste entschuldigen, weil er für mehr Chancen für „coloured“ Schauspieler und Schauspielerinnen bei der Besetzung in Film und Fernsehen plädierte. Was war sein Fehler? Es hätte heißen müssen „poc“ (person of colour/people of colour). Voss fragt zurecht nach dem semantischen Unterschied von „coloured“ und „poc“.
Als ähnlich überzogene Reaktionen zitiert sie in Bezug auf Transmenschen Tipps, die mittlerweile sogar RTL denjenigen gibt, die in angemessener Form „Trans* sensibel“ sprechen wollen. „Er wurde als Mädchen geboren“ gilt als unzulässig, denn die Geschlechtsidentität werde nicht durch die Genitalien bestimmt. Genauso verpönt sei „Als sie noch ein Mann war“, richtig hingegen „als sie noch als Mann lebte“. Voss weist auf den Widerspruch hin, wenn Frauen als „Personen mit Eierstöcken“ bzw. als „Gebärende“ bezeichnet werden, denn hier würden Frauen (oder was auch immer sie sind) auf biologische Merkmale reduziert, was man gleichzeitig vehement ablehne.
Voss gibt weitere Beispiele aus dem Machtbereich der neuen Wokeness, die einen Zwang zur Anpassung und Unterwerfung zur Folge haben. Sie nennt das Disziplinierung und Abrichtung einer gesellschaftlichen Mehrheit, auf die Empfindlichkeiten sich immer weiter ausdifferenzierender, sich diskriminiert fühlender Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Es werde geradezu Jagd gemacht auf Sprachdelinquenten, die man dann an den öffentlichen Pranger stelle.
Voss wirft den neuen Sittenwächtern vor, ihren eigenen Machtanspruch zu verschleiern. Dahinter stehe ein verzerrtes Verständnis von legitimer Macht, die sich offenbar nur rechtfertige, wenn sie aus vorangegangener Unterdrückung, Diskriminierung oder Ohnmacht entstanden sei.
Das Schlimme an dieser neuen Prüderie sei, dass sie jede inhaltliche Diskussion auf der formalen Ebene aushebeln und damit verhindern könne, wenn jemand die aus ihrer Sicht falschen Codes verwende. Es würden nicht mehr Argumente ausgetauscht, sondern wer sich „falsch“ verhalte, werde niedergeschrien und ausgebuht, Lautstärke ersetze den inhaltlichen Diskurs.
Pauline Voss entwickelt ihre Kritik auf hohem Niveau, wenn auch der ständige Bezug auf Foucault zunächst etwas sehr bemüht erscheint. Es ist ein notwendiges Buch, wenn man sich mit dem Für und Wider von politischer Korrektheit auseinandersetzen will. Ihre Herleitung der neuen Zwänge ist über weite Strecken sehr informativ und einleuchtend.
Allerdings gibt es ein großes „Aber“. Auch Pauline Voss verschleiert etwas hinter ihrem hohen Niveau des diskursanalytischen Ansatzes. Sie verbirgt sehr lange, dass sie sich auf einer konservativen Position ansiedelt, die eigentlich jegliche sprachliche Sensibilität gegenüber Minderheiten, gegenüber Frauen, unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten sowie unterschiedlichen Ethnien für übertrieben hält.
So macht sie gegen Ende ihres Buches geradezu einen Rundumschlag gegen sprachkritische Autoren und Autorinnen. Dazu gehört ihr fast abfälliger Kommentar über Judith Butler, einer der bedeutendsten Vorreiterinnen für gendergerechtes Sprechen und für die Definition von Geschlechtsidentitäten als sozialer Konstruktionen. Auch für Kim de l’ Horizon, der 2022 für sein Buch „Blutbuch“ den Deutschen Buchpreis erhielt, kennt sie keine Gnade. Offenbar will sie sich nicht darauf einlassen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich in der ihnen von Geburt an zugewiesenen Geschlechtsidentität fremd fühlen.
Ich hätte mir angesichts der sonst so differenzierten Argumentation der Autorin ein ausgewogeneres Urteil gewünscht, denn die Schwierigkeiten fangen doch eben dort an, wo ich die sozialen Ungerechtigkeiten und ihre Widerspiegelung in der Sprache durchaus erkenne und das auch ändern möchte, ohne neue Ungerechtigkeiten zu produzieren und ohne in einen dogmatischen Furor zu verfallen. Das bedeutet eine Gratwanderung, die schwierig ist und selbstkritisch gegangen werden müsste. Denn auch wenn ich sensibel sprechen will, möchte ich weder die Sprache noch mich selbst verbiegen. Ich vermisse bei Pauline Voss solche Überlegungen zu einem gelassenerem Umgang mit der Sprache, ohne alle „Wokeness“ zu verurteilen. So ist es doch zum Beispiel durchaus möglich, gendersensibel zu sprechen, ohne die auch in meinen Augen unsäglichen „Gendersternchen“, die ihrerseits mit umgekehrten Vorzeichen sexistisch sind, indem sie die männlichen Formen verstümmeln (etwa im Dativ: den Leser*innen unterschlägt, dass es im Maskulinum richtig „den Lesern“ heißen muss).
Insgesamt habe ich das Buch mit großem Interesse gelesen, zumal es auch sprachlich sehr klar und verständlich geschrieben ist. Es ist durchaus empfehlenswert für alle, die sich mit der neuen moralischen „Cancel-Culture“ kritisch auseinandersetzen möchten.
Das Buch ist im Europa Verlag erschienen. Es hat 199 Seiten und kostet 22 Euro.
Elke Trost

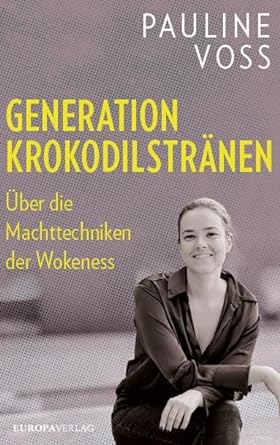
No comments yet.