In seinem neuen Roman „Valentinstag“ führt uns der US-amerikanische Schriftsteller Richard Ford in das Amerika des Middle-West, auf einen Road-Trip von der Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota, zum Mount Rushmore in South Dakota.
Es ist ein Road-Trip der anderen Art. Der 74 -jährige Frank Bascombe unternimmt diese Tour in einem alten Wohnmobil mit seinen 47-jährigen Sohn Paul, der an ALS erkrankt ist und nicht mehr lange zu leben hat.
In einem Prolog zum Thema „Glück“ umreißt der Ich-Erzähler Frank in knappen Worten sein ganzes Leben, sowohl beruflich als auch privat. Aus dem ehemals selbständigen Immobilienmakler ist nun im Alter ein Angestellter seines ehemaligen Mitarbeiters geworden, seine Tätigkeit ist eher symbolisch als wirklich wichtig. Zwei geschiedene Ehen gehören dazu, die erste, immer noch geliebte Frau ist an Krebs gestorben, der älteste Sohn mit 9 Jahren gestorben, Frank selbst hat eine Krebserkrankung durchgemacht. Dennoch sieht Frank sich nicht als einen unglücklichen Menschen. Seine Reflexion über das Glück lässt ihn zu einer sehr pragmatischen Lebensphilosophie kommen: „Alles, was nicht niederdrückendes Unglück ist, ist Glück“. Literatur ist für ihn ein Weg, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen: das „Glück entzieht sich immer, aber es bleibt das Ziel“. Mit dieser Devise kann er in seinem kleinen Haus in New Jersey gut leben.
Die Diagnose des Sohnes aber reißt Frank aus seinem Routine-Alltag heraus, als er beschließt, seinen Sohn in seiner letzten Lebensphase zu begleiten.
Die erste Etappe ist die Mayo-Klinik in Minnesota, ein Rundum-Gesundheits-Kosmos, der Patienten sowie begleitende Angehörige geradezu in sein System einsaugt, ohne dass ihnen eigene Entscheidungen bleiben. Paul nimmt hier über mehrere Monate an einer Studie zur Erforschung seiner Krankheit teil. Dabei geht es weniger um ihn als leidenden und sterbenden Menschen als vielmehr um die Profilierung von Ärzteschaft und Wissenschaftlern. Vater und Sohn logieren in dieser Zeit in einem gemieteten Haus, das von den Eigentümern mit allen Merkmalen ihrer persönlichen Lebensform belassen worden ist. Frank fühlt sich hier seltsam fremd, als tauche er in ein fremdes Leben ein.
In diesen drei Monaten beginnt die neue Vater – Sohn – Beziehung. Sehr vorsichtig tasten sie sich aneinander an, nachdem sie sich durch ihre unterschiedlichen Lebenswelten fremd geworden sind. Frank sucht nach dem richtigen Umgang mit dem todkranken Sohn. Ist eher Fürsorge angesagt? Oder ein Verhalten, das den Kranken nicht als solchen stigmatisiert, sondern ihn als vollwertiges Gegenüber ansieht, dem man auch etwas zumuten kann und mit dem man auch streiten kann?
Frank lernt im Laufe der Monate zwischen diesen beiden Polen ein Gleichgewicht zu halten. In ihren Gesprächen geht es um die Familiengeschichte, um Franks Rolle als Vater und Ehemann ebenso wie um die Fragen von Krankheit, Alter und Sterben. Angesichts eines nicht mehr fernen Lebensendes haben Vater und Sohn die gleiche Perspektive. Als alter Mensch stellt sich für Frank die gleiche Frage, wie sie sich für Paul stellt: Wie füllt man die einem zugestandene letzte Lebensphase sinnvoll und erfüllend? Ist es eher die Auseinandersetzung mit dem bisherigen Leben oder gibt es noch einen Blick in die Zukunft, so kurz sie auch sein mag? Für Frank ist es die Sehnsucht nach einer zärtlichen Liebesbeziehung, die er glaubt zu einer Prostituierten in Rochester gefunden zu haben.
Es ist Paul, der die schwierigen Themen immer wieder anschneidet, ihm geht es um das Leben, nicht um das Sterben. Die Gespräche mit dem Vater sind oft provokant, aggressiv und kritisch. Es gibt immer wieder Szenen, in denen sich die Vater-Sohn-Beziehung umzukehren scheint. Paul ist der Belehrende und Zurechtweisende, der den Vater zu Erklärungen und Rechtfertigungen zwingt. Die Umkehrbarkeit ihrer Beziehung ist auch in den Zahlen 74 und 47 verborgen.
Aus dem System „Mayo“ fliehen Frank und Paul vor dem letzten Event für die austherapierten Patienten. Es ist Franks Idee, mit Paul zum Mount Rushmore in South Dakota zu fahren, um den Sohn noch einmal ein besonderes amerikanisches Highlight erfahren zu lassen. Die Fahrt mit dem klapprigen Wohnmobil ist eine Tour durch den „American Way of Life“: endlose, gerade ausführende Highways, seelenlose Betonstädte an der Highway, trostlose Motelunterkünfte. Das altersschwache Wohnmobil ist eine Metapher für seine beiden Insassen. Paul kämpft mit der zunehmenden körperlichen Schwäche, schwankt zwischen Resignation und Aufbegehren und Überschätzen der eigenen Möglichkeiten. Ebenso spürt Frank die Überforderung mit der Aufgabe, sowohl psychisch als auch physisch. Belastend ist insbesondere die Wahrnehmung von Pauls zunehmendem Verfall. Frank beobachtet sich selbst, wie er Paul oft mit einem diagnostisch-distanziertem Blick betrachtet, mit dem er die Hässlichkeit des Kranken und seine provokante Selbstinszenierung wie ein Jugendlicher mit Käppi und Motto-T-Shirts registriert. Als Leserin bin ich mir unsicher über die Art von Franks väterlichen Gefühle, aber eben das scheint Franks Problem zu sein.
Angesichts der großen Schwierigkeiten stellen beide den Sinn dieser Reise immer wieder in Frage, um sie dann aber doch fortzusetzen, denn der Weg ist das Ziel.
Die Beschreibung der Ankunft in Rushmore ist ein Highlight des Romans. Ford schildert die Sinnlosigkeit des Besuchs dieser nationalen Sehenswürdigkeit, die selbst völlig bedeutungslos erscheint. Die touristische Kommerzialisierung ist hier konzentriert zu erfahren. Die Sache selbst interessiert gar nicht, nur das Selfie-Foto, und dann geht es schon weiter zu anderen Vergnügungen. Nicht zufällig ist es der Valentinstag, selbst eine Kommerzialisierung von Liebe und Freundschaft. Entsprechend lakonisch ist auch der Austausch von Geschenken zwischen Vater und Sohn.
Diese Erfahrung der Leere aber ist es, die Paul gerade als Sinn ihrer Reise sieht. Hat es für ihn etwas Tröstliches, dass diese Welt so wenig bietet, dass er auch gehen kann?
Und für Frank? Welche Lebensperspektiven werden sich für ihn noch öffnen? Er wird erkennen, dass es nicht mehr die großen Würfe sind, vielmehr die überschaubaren Aktivitäten, wie sie zum Beispiel die Möglichkeiten zu sozialem Engagement bieten.
Am Ende ist es dann doch ein Buch über das Alter und die Frage, wie über 70-jährige noch ein erfülltes Leben führen können. Tröstlich für ihn ist, dass laut Statistiken bei den über 70-jährigen das Glücksgefühl stetig zunehme, während es im dritten und vierten Lebensjahrzehnt abnehme und seinen Tiefpunkt am Beginn des 5. Lebensjahrzehnts habe.
Richard Fords Roman ist ein überaus komplexes Gebilde mit kunstvollen Verknüpfungen der verschiedenen Erzählebenen. Die Dialoge zwischen Vater und Sohn lassen uns ganz nahe an die Figuren heran. Die innere Spannung der beiden zeigt sich in einer Sprache, die trotz des Bildungsstandes der Sprecher mit Vulgärausdrücken und umgangssprachlichen, geradezu nachlässigen Wendungen gespickt ist. Auch an dieser Sprache zeigt Richard Ford ein amerikanisches Phänomen: die Reduktion der Sprache auf das Notwendige, der Verzicht auf Differenzierung und sprachliche Richtigkeit. Es ist allerdings eine Frage, ob das wirklich ein typisch amerikanisches Phänomen ist. Denn sprachliche Verrohung und Vereinfachung lassen sich auch in unserem deutschen Sprachgebrauch zunehmend beobachten. Daran mögen social media nicht unbeteiligt sein.
Insgesamt ist „Valentinstag“ ein anspruchsvoller, unbedingt empfehlenswerter Roman. Der deutsche Titel ist bereits ein Verweis auf die Auseinandersetzung mit der Kommerzialisierung des Lebens in allen Bereichen. Der Original-Titel „Be Mine“ ist dagegen viel verrätselter. Darüber weiter nachzudenken, überlasse ich den potenziellen Leserinnen und Lesern.
Der Roman ist in der Übersetzung aus dem Amerikanischen von Frank Heibert im Hanser Verlag erschienen, hat 413 Seiten und kostet 28 Euro.
Elke Trost

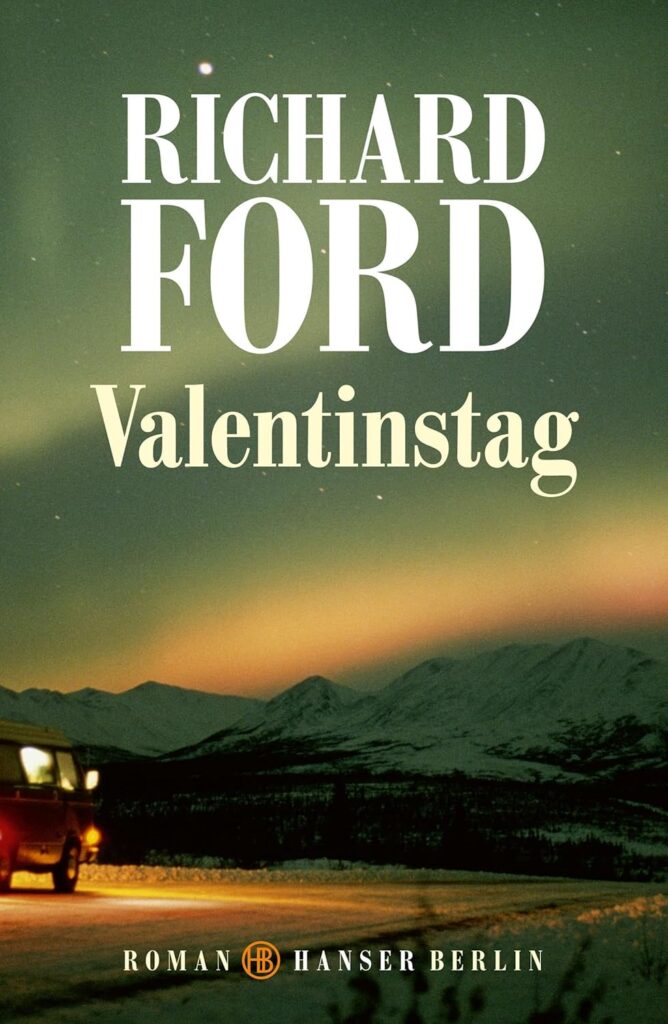
No comments yet.