Im Umfeld der von den USA nach Europa geschwappten Diskurse über die „Critical Race Theorie“ oder „Cancel Culture“ hat auch der Begriff des Privilegs eine völlig neue Färbung erhalten, zumindest innerhalb der Diskurskreise. Da diese sich jedoch, vor allem über den universitären Raum, immer weiter ausbreiten, greifen die neuen Begriffe immer weiter in den Alltag hinein.
Der Züricher Kunsthistoriker Jörg Scheller beginnt bereits im Vorwort, die Menge der angeblichen Privilegien anhand einer spontanen Google-Suche aufzulisten. Ohne die in die Tausende gehende Zahl der Einträge näher zu beleuchten, lässt er in einem eigenen Prolog zwei Seiten von Privileg-Varianten auf die Leser niederprasseln. Anschließend geht er auf die aktuelle Wirkung des Begriffs ein, die für ihn trotz wiederholter Betonung der Neutralität einen deutlich (ab)wertenden Charakter aufweist, da die Erwähnung von Privilegien meist implizit oder gar explizit mit Adjektiven wie „ungerecht“ oder „unverdient“ verbunden ist. Für Scheller liegt auf der Hand, dass dieses Wort längst zu einem Kampfbegriff geworden ist, der mit einkalkulierter Sicherheit das entsprechende Empörungspotential freisetzt.
Als Wissenschaftler erkundet Scheller erst einmal die lateinische Herkunft sowie die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs. Früher wurden verdienten Mitbürgern „Vorrechte“ (privae leges) eingeräumt, die in vielen Fällen im Sinne des jeweils herrschenden Systems – Feudalismus, Klerus, etc. – durchaus berechtigt waren. In vielen Fällen würde man das heute auch noch sagen. Andererseits wurden und werden z. B. Neusiedlern in vermeintlich unattraktiven Regionen (befristete) steuerliche Vorrechte eingeräumt, die höchstens von wenigen Aktivisten in Frage gestellt werden. Der Begriff ist also ursprünglich zumindest neutral, wenn nicht gar positiv „konnotiert“, wie man heute so schön sagt.
Dagegen gewinnt der Begriff im akademisch-aktivistischen Umfeld eine völlig neue Bedeutung, etwa wenn die Diskussion der Aufteilung von Hausarbeit in einer Familie als „Luxusproblem Privilegierter“ denunziert wird. Scheller geht diesen Unterstellungen in konkreten Fällen nach und zeigt, dass gerade die so als „Privilegierte“ beschimpfte Personen sich aus kleinsten, „unterprivilegierten“ Verhältnissen in eine bescheidene Mittelschicht hochgearbeitet haben. Er tut dies nicht, um Erbsen zu zählen, sondern um am konkreten Fall zu zeigen, wie unreflektiert und ohne Kenntnis der jeweiligen Situation diese Einordnung erfolgt, offensichtlich nur, um die eigene Ideologie und das Selbstwertgefühl des „besseren Menschen“ zu stärken.
An den Beispielen verschiedener Punks und Hard-Rocker zeigt er, wie diese sich aktiv mit tatsächlich oder vermeintlich Unterprivilegierten solidarisierten, teilweise unter Preisgabe der eigenen bildungsbürgerlichen Herkunft. Dabei näherten sie sich sowohl dem Habitus als auch der Sprache der sozialen Verlierer an, um ihnen dadurch Respekt zu erweisen. Dagegen verhält sich für ihn die akademische Elite durchaus kontraproduktiv, indem sie zwar die bildungsbürgerlichen „Privilegien“ dekonstruiert, aber in einem akademischen Jargon, den nur ihresgleichen verstehen. Die akademischen Aktivisten gegen die Privilegien distanzieren sich somit de facto von den vermeintlich Unterprivilegierten und machen sich damit unfreiwillig(?) selbst zu Privilegierten.
Auch die apodiktischen Verknüpfung von „weiß“ (sprich: westlich), „privilegiert“ und „individualistisch“ der Aktivistin DiAngelo widerlegt Scheller mit deutlichen Nachweisen. So habe einerseits schon Hegel für kollektive Gesellschaftssysteme plädiert, und darüber hinaus hätten gerade die westlichen Kulturen die bisher schlimmsten Kollektivsysteme entwickelt. Außerdem heiße „individualistisch“ nicht „unsozial“, wie man an den europäischen Sozialstaaten oder selbst in den USA an der Charity-Kultur sehen könne.
Als besonders fragwürdig betrachtet er die Einstufung Israels als „weiß-privilegiert“ und damit implizit als Tätergesellschaft. Die Erklärung, die Nazis hätten Juden entgegen deren Eigeneinschätzung als nicht „weiß“ deklariert und damit gebe es weiterhin keinen Rassismus gegen Weiße, stuft Schöller zu Recht als grotesk ein. Darüber hinaus verweist er vor allem auf osteuropäische Völker, die schon vor dem Dritten Reich trotz ihrer weißen Hautfarbe mit eindeutig rassistischen Vorurteilen und Repressionen konfrontiert waren. Die Monopolisierung des Rassismus auf die Täter-Opfer-Beziehung „Weiß“ und „Schwarz“ ignoriert nicht nur diese sondern auch verschiedene asiatische Ethnien, die ebenfalls kurzerhand als „weiß“ deklariert werden.
Die Verbindung „weiß“ und „privilegiert“ stellt Scheller nicht nur generell anhand breiter unterpriviligierter „weißer“ Gesellschaftsschichten in Frage, sondern auch bei näherer Betrachtung der afro-amerikanischen Aktivistenszene selbst. Gerade einige der herausragenden Figuren dieser Szene stammen demnach nachweisbar aus akademischen, beruflich erfolgreichen Familien. Scheller betont dabei ausdrücklich, dass das nicht gegen die Benachteiligung weiter – übrigens nicht nur! – afro-amerikanischer Kreise vor allem in den USA spreche, aber die automatische Konnotation von „weiß“ und „privilegiert“ sei damit nicht mehr haltbar, sondern erweise sich als reiner Kampfbegriff. Das sehe man auch an den weltweiten Fluchtbewegungen, die nicht nur aus „schwarzen“ hin zu „weißen“ Gesellschaften erfolge. Letzteres zeigt er anschaulich am Beispiel des vermeintlich durch seine Geburt privilegierten Apple-Mitbegründers Steve Wozniak, dessen Eltern als Diskriminierte aus dem östlichen Polen in die USA ausgewandert waren.
Der Autor kritisiert in diesem Buch deutlich die bewusst schwammige Verwendung des „Privileg“-Begriffs, die es erlaubt, auch Widersprüche zu ignorieren, soweit sie nicht unmittelbar nebeneinander stehen. Wendet man diesen und die anderen inkriminierten Begriffe wie „weiß“ und „individualistisch“ jeweils punktuell in einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld an, so lässt sich damit ein plausibles Bild von Tätern und Opfern entwickeln. In einem anderen, eventuell entgegengesetzten Umfeld ändert man dann die Definitionen der Begriffe etwas ab, um dort dasselbe zu erreichen. Die oben erwähnten Widersprüche lässt man durch Reduzierung einfach unter den Tisch fallen.
Scheller weiß, dass Rassismus aus guten – d.h. eigentlich „schlechten“ Gründen – ein sehr brisantes Thema ist, bei dem man mit Kritik schnell über das Ziel hinausschießen und sich selbst den Verdacht des Rassismus einhandeln kann. Er achtet daher streng darauf, nicht nur jegliche vordergründige Polemik zu vermeiden, sondern bei jeder Kritik an dem derzeit dominierenden Diskurs auf die grundlegende Berechtigung der Kritik an einem immer noch weit verbreiteten Rassismus zu verweisen. Er führt aber auch eine Reihe von Belegen dafür an, dass die Situation vor allem der farbigen Bevölkerung der USA sich in den letzten Jahr(zehnt)en deutlich verbessert hat, wenn auch immer noch deutliche Mängel zu verzeichnen sind. Die in diesem Buch kritisierte frontale Pauschalkritik mit unklaren weil leicht redefinierbaren Begriffen führe zu verhärteten Fronten ohne praktische Verbesserungen für die Betroffenen. Er bewegt sich damit im Gleichklang mit McWorthers Buch „Die Erwählten„, der sogar noch praktische Vorschläge unterbreitet.
Das Buch ist im Hirzel-Verlag erschienen, umfasst 149 Seiten und kostet 19,90 Euro.
Frank Raudszus

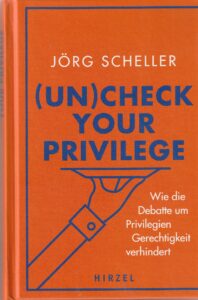
No comments yet.