In dem neuen Roman „Der falsche Gruß“ von Maxim Biller geht es vordergründig um das Geschäft mit der Literatur, um Konkurrenz sowie um das Verhältnis von Wahrheit und Lüge im literarischen Text. Dahinter entwickelt Biller eine politische Dimension, die Ausgrenzung, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland in Ost und West, in der Vergangenheit und in der Gegenwart thematisiert.
Fünf Jahre nach seinem ersten Vertrag mit einem renommierten Verlag erinnert sich der Ich-Erzähler Erck Dessauer an den denkwürdigen Tag, als er für sich allein in der Berliner Bar Trois Minutes die Vertragsunterzeichnung feiert. In eben dem Lokal sitzt zur selben Zeit der jüdische Erfolgsschriftsteller Hans Ulrich Barsilay, dem er schon einmal flüchtig begegnet ist.
Sofort geht in Ercks Kopf eine mögliche Geschichte ab, in der er imaginiert, Barsilay würde alles tun, um sein Buch über den Gulag-Organisator Frenkel zu sabotieren. Es endet damit, dass Erck sich vor den Schriftsteller mit einem kurzen Hitlergruß aufbaut und dann verschwindet.
Dieser Gruß verfolgt ihn lange Zeit, ständig in der Angst, für diese Entgleisung von Barsilay rechtlich belangt und damit als Schriftsteller erledigt zu werden.
Inzwischen ist er offenbar einigermaßen arriviert, lebt jedenfalls in einer großen Altbauwohnung, dennoch geht ihm die Geschichte mit Barsilay nicht aus dem Kopf, hat er doch selbst zu dessen Sturz beigetragen. Ob aus Neid und Eifersucht oder aus tatsächlichem Streben nach der Wahrheit, jedenfalls geht er dem Hintergrund von Barsilays autobiographischem Erfolgsroman „Meine Leute“ nach. Er findet heraus, dass die Erzählung von dessen schockartiger Lähmung nach einem Auschwitz-Besuch eine reine Erfindung ist. Damit beruht der große Erfolg des Buches auf einer Lüge. Erck veröffentlicht dazu einen Artikel in der „Zeit“, danach ist von Barsilay nichts mehr zu hören.
Das ist die Rahmen-Erzählung, in die Biller in zahlreichen Rückblicken die eigene Familiengeschichte, deren Verstrickung in Nationalsozialismus und DDR-Diktatur einbaut. All das dient seinem egomanen Ich-Erzähler Erck dazu, die eigene Person in ihrer vermeintlichen Sonderstellung zu charakterisieren als denjenigen, der viel Leidvolles erfahren hat und mit kritischem Blick die Verlogenheit der anderen entlarvt.
Gleichzeitig stellt er sich dem Leser ungewollt als einer dar, der selbst polarisiert, etwa wenn er Barsilay als einen von „ihnen“ benennt, denen er das „wir“ gegenüberstellt. Er tut damit das Gleiche, was Barsilay tut, wenn er in seinem Roman „Meine Leute“ ebenso „uns“ – d.h. die jüdische Bevölkerung – von „ihnen“, den Nicht-Juden, abgrenzt. Als Ostdeutscher wiederum fühlt Erck sich von den „Wessis“ als „Ossi“ diskriminiert.
Erck macht den Eindruck eines selbstgerechten Mahners, der Lüge und Egoismus immer bei den anderen sieht. Dabei wird sich herausstellen, dass er selbst es mit der Wahrheit auch nicht so genau nimmt, vielmehr seine Geschichte in verschiedenen Variationen erzählt.
Dass ihm als Erzähler nicht ganz zu trauen ist, deutet er schon in seinem ersten Satz an, denn er weiß selbst nicht mehr genau, wie das mit dem Hitlergruß wirklich war, ob es ein angedeuteter Hitlergruß oder nur das „verrutschte Armwedeln eines Betrunkenen“ war. Aber die Geschichte erzählt sich eben gut. Oder auch ganz anders.
Andererseits bemüht sich der Erzähler um Authentizität: Die Orte, die er nennt, kann man auf der Karte identifizieren, die historischen Ereignisse oder die erwähnten historischen Personen bei Wikipedia finden.
Maxim Biller spielt mit dem Thema Autofiktion oder auch Memoir und lotet so die Möglichkeiten der literarischen Freiheit aus. Muss Literatur „wahr“ sein, oder ist ihr nicht gerade die „Lüge“ inhärent? Darf ein Autor lebende Personen als solche erkennbar in seinen Romanen darstellen, und ist ein Verbot solcher Texte schon Zensur? In Billers Roman wird Barsilay wegen seines Romans „Lustlos“ der Prozess gemacht, was dieser völlig ungerechtfertigt findet. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Biller damit auch das Druckverbot gegen seinen Roman „Esra“ meint.
Biller gelingt es, die vielen Schichten seines Romans elegant zu verknüpfen, oft assoziativ, wie sein Erzähler eben denkt. Dann aber auch tiefer gehend, wenn er historische Zusammenhänge oder Personen näher beleuchtet, die den Leserinnen und Lesern so wohl nicht immer präsent sind. Für die Leserin ist das Buch immer wieder ein Anreiz, sich weiter zu informieren, vielleicht auch, um die „Wahrhaftigkeit“ des Erzählers zu überprüfen. Die Leserin verlässt das Buch mit einiger Ambivalenz dem Erzähler gegenüber. Im historischen und politischen Bereich ist ihm zu trauen, was die Fakten anbetrifft, in der Darstellung seiner eigenen persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen ist ihm nicht so recht zu trauen. Ist er nicht am Ende doch nur der kleine Gernegroß, der es dem großen Barsilay einmal richtig gezeigt hat? Und Barsilay? Lässt er sich von diesem Möchte-Gern-Schriftsteller einschüchtern? Ist er wirklich von der Bildfläche verschwunden? Der Schluss lässt uns zu dieser Frage verunsichert zurück.
Und überhaupt: Wer ist denn nun Barsilay? So ganz unähnlich scheint er dem Autor nicht zu sein. Den kennt man von seinen ZEIT-Kolumnen und von seinen Auftritten im „Literarischen Quartett“. Man kann nicht sagen, dass er kein Selbstbewusstsein hätte und nicht von seiner intellektuellen Überlegenheit über die meisten Mitmenschen überzeugt wäre.
Dennoch: Biller ist ein Autor, der die Leserin herausfordert, sich seiner Arroganz, aber auch seinem Wissen und seinem Scharfsinn immer wieder mit einer gewissen Hass-Liebe auszusetzen. Langweilig ist das nie.
Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen, hat 108 Seiten und kostet 20 Euro.
Elke Trost

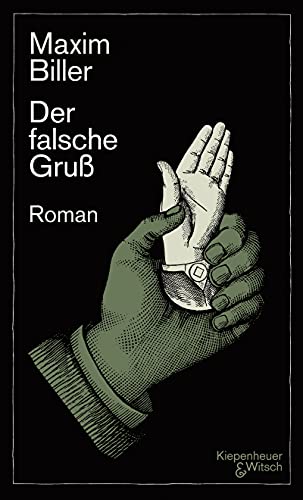
No comments yet.