Byung-Chul Han, Jahrgang 1959, ist Koreaner, lebt und arbeitet aber seit seinem Studium in Deutschland. Das vorliegende Buch hat er daher auch auf Deutsch verfasst und weist sich dabei als stilsicher in seiner zweiten Heimatsprache aus. Soviel zum Sprachlich-Stilistischen.
Inhaltlich nimmt er die Informationsgesellschaft mit der Digitalisierung des täglichen Lebens aufs Korn. Er sieht den Menschen als ursprünglichen Partner und Bearbeiter der „Dinge“, die ihn seit altersher umgeben. Mit „Ding“ bezeichnet er, ganz im Sinne der herkömmlichen Philosophieschulen, alles, was außerhalb des menschlichen Bewusstseins liegt und seine Umgebung bildet, vor allem die haptischen „Dinge“ wie Waffen, Werkzeuge und Wohnungen. Früher habe der Mensch auf der Erde (faktisch) und im Himmel (gedanklich) gelebt, wobei beide Territorien als physisch verstanden wurden. Mit einem schönen – oder platten?? – Wortspiel behauptet Han, der Mensch des Informationszeitalters lebe jetzt stattdessen in „Google Earth“ und der „Cloud“. Die Dinge, mit denen er früher bei der Arbeit und in der Freizeit zu tun gehabt habe, seien jetzt informatisiert worden und begegneten ihm nur noch als digitale, also „virtuelle“ Entitäten. Damit seien die „Dinge“ zu „Undingen“ geworden. Dabei beruft er sich gleich zu Beginn auf seine wichtigste Bezugsquelle: Martin Heidegger . Den deutschen Leser verwundert die wiederkehrende Faszination, die ein in Deutschland bereits umstrittener wenn nicht abgeschriebener Philosoph vor allem auf Menschen aus fremden Kulturkreisen ausübt. Man kennt dieses Phänomen unter anderem von französischen Wagner-Verehrern.
Han erhebt das Heideggersche „Ding“ zu einem für das authentische Überleben der Menschheit unabdingbaren Fetisch. Für ihn kann der Mensch die Welt im wahrsten Sinne des Wortes nur als physische „begreifen“. Die Digitalisierung erlaubt ihm lediglich den „Zugang“ zu den Dingen, nicht aber ihren „Besitz“, der ihn erst zum selbstgewissen Teilhaber der – letztlich immer dinglichen – Welt mache. Die zumindest theoretische Möglichkeit einer nicht „dinglichen“ sondern informationellen Weltsicht schließt Han von vornherein aus.
Von dieser Grundeinstellung ausgehend schließt er ganz konsistent, dass der Mensch den Besitz, die innere „Aneignung“ der Dinge gegen ein „Erlebnis“ eingetauscht habe. Hier kann man ihm durchaus folgen, weil die heutige Informationswelt – Internet und Smartphone – tatsächlich weitgehend vom Informationskonsum und der Sucht nach Neuigkeiten geprägt ist. Dabei nimmt laut Han die Halbwertszeit dieser Informationen laufend ab, da nur die neueste Information noch einen Wert besitzt. Die Teilhabe an der Oberfläche der Welt gilt mehr als das Eintauchen in die Details – die „Dinge“ – der Welt.
Das zeigt Han überzeugend am Beispiel des Smartphones, auf das sich die Aufmerksamkeit der Menschen immer stärker konzentriere. Als schönes Beispiel führt er den Federhalter an, dessen Führung bei der Herstellung von Texten die ganze Hand erfordere. Heute reichten die Fingerspitzen, um vorgefertigte Buchstaben abzurufen. Das Smartphone nehme dem Menschen buchstäblich die „Hand-lung“ ab und reduziere ihn vom tätigen Teilhaber der Welt zum nur noch konsumierenden Betrachter. Auch hier zitiert Han wiederum ausgiebig Heidegger, der schon die Schreibmaschine als Degenerierung gegenüber der Handschrift denunziert hatte.
Bereits hier ist der kulturpessimistische Tenor von Hans Philosophie erkennbar, der den „Fortschritt“ grundsätzlich als Zerstörer nicht nur althergebrachter, sondern darüber hinaus notwendiger Bedingungen authentischen menschlichen Daseins betrachtet. Dabei setzt Han die Zäsur willkürlich mit dem Informationszeitalter an. Dass bereits die Industrialisierung mit ihren neu produzierten „Dingen“ oder gar der Buchdruck mit der revolutionär flexiblen Kombination informationeller Grundelemente (Buchstaben) solche Zäsuren bewirkt hat, ignoriert er – ob bewusst oder unbewusst, sei dahingestellt.
Sein Essay über das „Selfie“ ist dafür ein gutes Beispiel. Ausgiebig zitiert er Roland Barthes Essay über die (analoge) Fotografie, die dieser mit geradezu leidenschaftlicher Pose zum Inbegriff der Ausdrucksstärke erklärt und dem Fotoabzug selbst den Transport von Innigkeit, Erinnerung und echter Beziehung zuschreibt. Han übernimmt diese Eloge und stellt sie dem seelenlosen Digitalbild gegenüber, das nur aus Daten bestehe und daher nur kalte Information liefere.
Unabhängig von der ganz persönlichen Wirkung eines Fotoabzugs auf den Betrachter ist dazu anzumerken, dass auch ein analoges Photo im Entstehungszustand aus durch Lichteinfall geänderten Molekülen besteht, die ein Chemiker einfach mit Daten beschreiben kann. Andererseits wird auch ein Digitalfoto – wenn überhaupt – auf Fotopapier gedruckt, das denselben Verwitterungsbedingungen wie sein analoges Pendant unterliegt. Die Wirkung eines Fotos auf den Betrachter kann daher wohl kaum auf den Herstellungsprozess zurückgeführt werden, sondern liegt allein im Auge des Betrachters. Allerdings liegt Han insofern richtig, als heute Fotos auf dem Smartphone weg-„gewischt“ werden und nicht mehr, wie noch vor fünfzig Jahren, die Wohnzimmerwände zieren.
Han führt diese Entwicklung auf das zunehmende „Ego“ der Menschen zurück. Die Digitalisierung mit ihren vielfältigen Informations- und Konsummöglichkeiten ist für ihn Voraussetzung für eine zunehmende Ausweitung des Egos auf die Welt und einer damit einhergehenden Abwendung von der „dinglichen“ Welt sowie der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das führe letztlich zur Vereinsamung der Konsumenten und zum Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Den – hingeworfenen – Verweis auf den Kapitalismus ohne weitere Herleitung kann sich Han dann auch nicht verkneifen.
Ein ganzes Kapitel widmet Han der Künstlichen Intelligenz, der er die Möglichkeit eigenen Denkens rundweg abspricht. Dies belegt er – wieder! – mit Heideggers Behauptung, dass jedem Denken eine „Grundstimmung“ vorangehe, die im Menschen ohne logische Begründung angesiedelt sei. Diese fast mythische, wenn nicht mystische „Grundstimmung“ wird nicht näher definiert, sondern schwebt sozusagen aus transzendenten Höhen ein. Man fragt sich natürlich, ob sie genetischen Charakters ist und damit subjektiv individuell ausfällt, was allgemeines Denken eigentlich ausschließt, oder ob sie in irgendeiner Form territorial, ethnisch oder gar global auftritt, wobei wiederum der Entstehungsprozess zu erfragen wäre. Auch von einem Philosophen wie Heidegger (oder Han) hätte man gerne nähere und belastbare Angaben über diese denkerische „Grundstimmung“ erhalten, doch sie bleibt als „gesetzte“ Voraussetzung für jegliches Denken stehen und schließt damit die KI von vornherein apodiktisch von jeglichem „intelligenten“ Denkprozess aus. Wie einfach – wenn auch anspruchsvoll formuliert.
In einem ausgedehnten Kapitel geht Han dann auf einige Eigenarten der „Dinge“ ein. Dabei entwickelt er eine Menge durchaus origineller und erkenntnisreicher Gedanken, allerdings mit tatkräftiger Unterstützung von Helfern wie Agamben, Barthes, Derrida, handke und – natürlich! – Heidegger. Zeitweise, so wenn er Rilke zitiert, schweift Han ins Romantisch-Raunende ab oder beschwört mit Saint-Exupérys „Kleinen Prinzen“ die Dinge, die man nur mit dem Herzen sehen könne. Diese Literaten bewohnen jedoch ihre jeweils eigene Welt mit entsprechendem Vokabular und intellektuellen oder emotionellen Befindlichkeiten, die sich nicht einfach in die – hoffentlich – konsistente Welt der Philosophie einbetten lassen, und schon gar nicht als Beweise für eine Hypothese.
Dafür liefert Han im Kapitel über die „Stille“ noch einmal ein eindrucksvolles Plädoyer für das Zuhören, nicht nur gegenüber menschlichen Partnern, sondern vor allem gegenüber den trivialen „Dingen“ der Welt. Wenn auch mit bisweilen raunendem Tonfall beschwört Han das Eigenleben der dinglichen Welt – die alles umfasst außer dem Ego des Menschen – und betrachtet die Stille als die Selbstentäußerung eben dieser Natur, die der Mensch in seinem Machbarkeits- und Herrschaftswahn nicht vernehmen könne. Erst das sich selbst zurücknehmende Zuhören gebe dieser „Stille“ den nötigen Freiraum, um sich mitzuteilen. Rationalisten mögen diese Ausführungen für esoterisch oder gar sektiererisch halten, doch haben sie durchaus etwas für sich.
Dagegen zeigt das letzte Kapitel über die „Jukebox“ noch einmal die Ambivalenz dieses Buches. Han schwärmt dort von der Anschaffung einer Jukebox aus den Sechzigern mit ihren bunten Lichtern und den nostalgischen Songs. Für ihn ist diese Box – ungeachtet seiner leicht augenzwinkernd-verschämten Selbstironie – das authentische „Ding“ in seiner ganzen Unmittelbarkeit. Ganz abgesehen davon, dass Jukeboxen zur damaligen Zeit bereits ausgefeilte (informations)technische Komponenten enthielten, stellten sie ein Paradebeispiel für die „kapitalistische“ Verwertung der emotionellen menschlichen Bedürfnisse dar. Zu ihrer Zeit dürfte kein Philosph sie als authentisches „Ding“ betrachtet haben. Diesen Charakter- oder Wertewechsel innerhalb von sechzig Jahren kann man wohl getrost dem Nostalgie-Effekt zuschreiben, und darüber hängt dann schon das Damoklesschwert des „K-Wortes“.
Störend wirkt in diesem durchaus anregenden Buch allerdings der übermäßige Anteil von Zitaten anderer Autoren sowie die inflationäre Hervorhebung bestimmter Begriffe durch Kursivsetzung. Die Zitate von Handke(!), Heidegger, Nietzsche, Barthes et al. sind zwar alle ordnungsgemäß gekennzeichnet und mit Quellenverweisen versehen, nehmen aber teilweise den Charakter von Nachdrucken an. Weniger wäre hier mehr gewesen und hätte Hans eigenen Gedanken mehr Gewicht verliehen.
Das Buch ist im Ullstein-Verlag erschienen, umfasst 125 Seiten und kostet 22 Euro.
Frank Raudszus

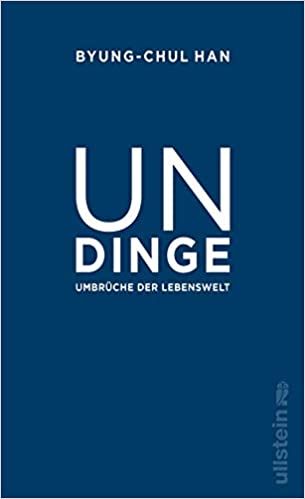
No comments yet.