Der Begriff des „Neoliberalismus“ erscheint in einem Großteil der heutigen Sachliteratur über Wirtschaft, Politik und Gesellschaft als negativ vorgespannter Kampfbegriff, gerne auch zusammen mit dem „(Spät-)Kapitalismus“. Auf eine Eingrenzung oder gar ausführliche Erklärung dieses Begriffs verzichten die Autoren dabei gerne, da sie ihn offensichtlich grundsätzlich für ausdiskutiert halten – und weil sich die jeweilige Zielgruppe mit seiner allseits bekannten normativen Aufladung mit hoher Wahrscheinlichkeit leichter einstimmen lässt.
Thomas Biebricher, Professor an der Copenhagen Business School, hat sich mit diesem Buch das Ziel gesetzt, nicht nur den Begriff zu klären, sondern vor allem seine ökonomisch-historische Bedeutung zu deuten und ihn entsprechend einzuordnen. Das ist ihm aus zwei Gründen hervorragend gelungen: erstens durch seine sachliche, analytische Argumentation, die auch bei kritischen Anmerkungen nie in ideologische Polemik umschlägt, und zweitens durch seinen klaren, auch bei komplexen Sachverhalten stets verständlichen Stil, der die Lektüre auch Nicht-Ökonomen erleichtert.
Biebricher beginnt mit einer Begriffsklärung, die er gleich mit der Entstehungsgeschichte und den wichtigsten Protagonisten verbindet. Viele Kritiker reduzieren den Neoliberalismus gerne auf eine Fetischisierung des „freien Marktes“, der alles von selbst regele. Dazu gehört dann natürlich auch die Forderung nach einem „Laissez Faire“ in allen Bereichen um diesen Markt herum, damit dieser ja nicht in seiner Entwicklung gestört werde. Schon in dieser frühen Klärungsphase erteilt Biebricher solchen – oftmals polemisch eingefärbten – Erklärungsmustern eine klare Absage und stellt fest, dass die Väter des Neoliberalismus stets – wenn auch alternierende – Anforderungen an die Umgebung gestellt haben.
Der Neoliberalismus ist demnach keine Begriffsschöpfung einer ideologischen Linken, sondern wurde in den 30er Jahren von einer Reihe bedeutender Ökonomen – gerne auch mit philosophischem Einschlag – entwickelt. Hintergrund waren die aufkommenden kollektivistischen Systeme wie der (Sowjet-)Sozialismus oder der Faschismus resp. Nationalsozialismus, die durchweg Wohlstand, Gerechtigkeit und Fortschritt durch staatliches Wirtschaften versprachen. Erstaunlicherweise waren in Europa – der Wiege des Neoliberalismus – mit Hayek, Eucken, Röpke und Rüstrow nur deutschsprachige Experten vertreten, während Biebricher aus dem englischsprachigen Raum vor allem den US-Amerikaner Buchanan zitiert.
Da der Neoliberalismus eher ein Bekenntnis denn eine stringente Theorie war, ergab sich unter den genannten Experten – und ihren Anhängern – natürlich eine große Bandbreite von Argumenten mit Widersprüchen bis hin zur Paradoxie. Da man diese kontroverse Situation – zumindest was die Logik betrifft – auch von den damals üblichen „Ideologien“ kennt, sind sie natürlich nicht à priori Totschlagsargumente sondern lohnen die Auseinandersetzung mit ihnen. Biebricher strukturiert das Thema dann nach vier verschiedenen Kontexten, mit denen der Neoliberalismus konfrontiert war und noch ist: dem Staat, der Demokratie, der Wissenschaft und der Politik. Davon scheinen sich beim ersten Hinsehen drei stark zu überschneiden, doch der zweite Blick zeigt, dass diese drei durchaus je eigene Perspektiven aufweisen, die vor allem für den Neoliberalismus wichtig waren.
Die spontane Ansicht, dass der Neoliberalismus einen schlanken – wobei eher „schwach“ gemeint ist – Staat wünscht, trifft laut Biebricher nur bedingt zu. Schon die Vertreter des frühen Neoliberalismus hatten erkannt, dass nur ein durchsetzungsstarker Staat die erwünschte Rolle des Schiedsrichters ausfüllen kann. Immer wieder zeigten sich damals schon Fälle, in denen der Staat aus verschiedensten Rücksichten Ausnahmen zuließ, die die Preisbildung und damit den Markt verzerrten. Außerdem benötigt der Markt auch eine Institution, die das Regelsystem für einen möglichst freien Wettbewerb festlegt, und auch das kann nur ein starker Staat. Da sich jedoch die Vertreter eines „starken Staates“ ihrer Stärke und damit ihrer Macht meist bewusst sind, nutzen sie diese gerne auch für entsprechende Eingriffe, die den Markt verzerren. Um die Metapher des Schiedsrichters noch einmal zu bemühen: sie nutzen nur zu gerne die Macht des Schiedsrichters, um etwa über ungerechte Elfmeter den Applaus des Publikums zu genießen. Biebricher zeigt am Beispiel einschlägiger Publikationen und Diskussionen der oben genannten Protagonisten, wie stark die Meinungen zur Rolle des Staates in einer neoliberalen Ökonomie bei gleichzeitiger Übereinstimmung in den Grundüberzeugungen voneinander abweichen können.
Die Demokratie betrachten fast alle neoliberalen Vertreter sehr kritisch, vor allem, weil eine Mehrheit Entscheidungen gegen alle neoliberalen – und daher gemäß Selbstverständnis vernünftigen – Grundsätze treffen und durchsetzen kann. Für sie waren bereits die Demokratien der dreißiger Jahre aus wahl- und damit machttaktischen Gründen in ihrer Struktur erstarrt. Das ging soweit, dass sich zum Beispiel ein Hayek (und nicht nur er) eine „Diktatur auf Zeit“ mit einem durchsetzungsstarken Führer wünschte, um die Verkrustungen der Demokratie aufzubrechen. Die Ironie der Geschichte hat ihm dann diesen „Führer“ geschenkt, aber gleich für katastrophale zwölf Jahre.
Die Wissenschaft scheint auf den ersten Blick der ideale Bundesgenosse des Neoliberalismus zu sein, weil dessen Erkenntnisse – zumindest aus der Sicht seiner Vertreter – auf wissenschaftlichem Wege gewonnen wurden. Doch auch wenn dies zutrifft, sind Wissenschaftler zwiespältige Bundesgenossen. Auch hier erkannten laut Biebricher einige neoliberale Protagonisten schon früh, dass die Wissenschaft nicht kompromissfähig ist, wenn sie einmal etwas für „wahr“ erkannt hat. Doch (Markt-)Wirtschaft ist stets in eine Realität eingebettet, die im Zweifelsfall Kompromisse erfordert. Obwohl sich die Protagonisten des Neoliberalismus als Wissenschaftler betrachteten, sahen sie eine zu starke Rolle der Wissenschaft zumindest als problematisch, wohl auch, weil sie ihre eigenes Berufsumfeld gut kannten. Dennoch herrschte und herrscht für Biebricher bei den Neoliberalen stets ein Hang zu technokratischen Regierungen, bei denen die Wissenschaft eine weitgehend beratende Rolle spielt.
Die Politik scheint mit „Staat“ und „Demokratie“ abgedeckt zu sein, doch Biebricher sieht auch hier eine eigene Perspektive. Während er den „Staat“ eher als Exekutive und die „Demokratie“ eher als Legislative sieht, ist die Politik für ihn der große Graubereich zwischen diesen beiden Institutionen, und sie lebt hauptsächlich von den Kämpfen um Macht und Wählerstimmen und damit von Kompromissen. Politik als Lebensumfeld ist aus seiner Sicht für die Neoliberalen daher ein ausgesprochen unsicheres Terrain, da der Neoliberalismus von der (ökonomischen) Freiheit des Individuums und dessen Vertrauen auf die Regeln eines „freien“ Marktes lebt. Wechselnde politische Tendenzen und Strategien sowie „faule“ Kompromisse sind für einen weitgehend autonom agierenden Markt Gift. Auch die „normativen“ Elemente der Politik, die dem Markt höhere, meist nicht konkretisierte Werte vorgibt, weckten schon früh den Argwohn der Neoliberalen. Als heutiges, von Biebricher nicht explizit vorgebrachtes, Beispiel lässt sich das „Lieferkettengesetz“ anführen, dass die sozialen Bedingungen in der Dritten Welt zu einem normativen Wert für hiesige Firmen erhebt, doch dabei die konkrete Umsetzung außer acht lässt. Auch beim Politik-Kriterium kam bei den frühen Neoliberalen der Wunsch nach einer „Übergangsdiktatur“ zum Ausdruck, die endlich Schluss mit den existierenden Verkrustungen der Märkte machen sollte.
Anhand dieser vier Kriterien zeigt Biebricher deutlich die Schwierigkeit, wenn nicht sogar die Unmöglichkeit, eine konsistente neoliberale Theorie zu entwickeln. Daraus schließt er jedoch nicht, dass der Neoliberalismus unhaltbar und damit am Ende ist, sondern lediglich, dass das Feld der Wirtschaftsordnungen per se zu komplex und widersprüchlich ist, als dass man es mit einer geschlossenen Theorie erfassen oder gar steuern könnte. Damit erteilt er der – sozialistischen oder kapitalistischen – Staatswirtschaft implizit dieselbe Absage, ohne das in diesem Buch zu thematisieren.
Im zweiten Teil betrachtet Biebricher die Stellung der EU zum Neoliberalismus bzw. Ordoliberalismus. Letzterer, eine Variante des Neoliberalismus, besteht im Kern aus der Eigenverantwortung der Marktteilnehmer – innerhalb der EU die einzelnen Nationalstaaten – einschließlich der Haftung bei Problemen. Hier sieht er Deutschland und Frankreich als Antipoden. Während die Franzosen eher zu einer staatlich gelenkten Wirtschaft einschließlich Haftungsübernahme für andere neigten, stünden die Deutschen für die Eigenverantwortung der wirtschaftlich agierenden Subjekte, sprich: die Privatwirtschaft bzw. in der EU die Nationalstaaten. Diesen Ordoliberalismus inklusive Austeritätspolitik habe Deutschland sowohl in der Finanzkrise – trotz Bankenrettung! – als auch in der Eurokrise konsequent durchgehalten auf Kosten von Ländern, die nicht über dieselben strukturellen wie kulturellen Bedingungen wie Deutschland verfügten. Hier prägt Biebricher das fast schon paradox anmutende Bonmot, dass die EU deutscher sein könnte, wenn Deutschland sich weniger deutsch verhalten hätte.
Im abschließenden Epilog kommt Biebricher nach einer Gegenüberstellung von Neoliberalismus und (Rechts-)Populismus auf die Entwicklung in den wichtigsten Ländern sowie auf die Folgen der Corona-Krise zu sprechen. Neoliberalismus und Rechtspopulismus verbindet in gewisser Weise der Autoritarismus, die „weiche“ Variante des Totalitarismus, doch Biebrichers Analyse zeigt, dass plakative Zuschreibungen an der Komplexität der Verhältnisse scheitern und als zwangsläufig vorausgesagte Entwicklungen nicht eintreten. Das erinnert an Marx´ Vorhersage, dass der Kapitalismus sich zwangsweise selbst abschaffen werde. Nach einem kurzen Gang durch einzelne Länder – Österreich, Italien, USA – und deren aktuelles Verhältnis zu Neoliberalismus und Austerität beschließt er dann den Epilog mit den Folgen der Corona-Krise, die mit der gemeinsamen Schuldenaufnahme der EU trotz gegenteiliger Beschwörungen durchaus den Einstieg in eine Schuldenunion mit sich bringen könnten.
Biebricher hat mit diesem Buch nicht nur eine konzise Analyse des Neoliberalismus vorgelegt, sondern gleichzeitig eine ökonomie- und finanzpolitische Bestandsaufnahme der EU zum Beginn des dritten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts. Jedem, der sich für dieses überlebenswichtige Zukunftsthema interessiert, sei die Lektüre dieses Buches ans Herz gelegt.
Das Buch ist im Suhrkamp-Verlag erschienen, umfasst 345 Seiten und kostet als Taschenbuch 22 Euro.
Frank Raudszus

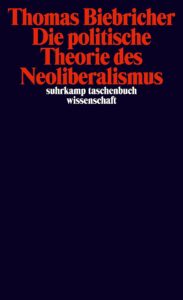
No comments yet.