Bei der Lektüre dieser Erzählung formulierte der Rezensent spontan die Erkenntnis „Der Schreibstil erinnert doch ganz deutlich an seinen Roman „Ulysses“.“ Voll daneben – denn der stammt bekanntlich von Becketts Landsmann James Joyce!
Aber ganz so falsch war diese Assoziation doch nicht, denn Joyce war lange Becketts Vorbild, dem er nacheiferte. Die frappierende Ähnlichkeit kann also durchaus zu solchen Kurzschlüssen führen.
Beckett hatte 1933 einen Erzählungsband abgegeben, der dem Verleger im wörtlichen Sinne etwas zu dünn war. Also empfahl er dem Autor, noch eine Erzählung hinzuzufügen. Da Beckett seinen durchgehenden Protagonisten der Erzählungen am Ende hatte sterben lassen und die Einbettung einer neuen Geschichte ihm angesichts der engen Verzahnung der vorhandenen zu schwierig erschien, ließ er seinen „Helden“ kurzerhand noch einmal vom Tode auferstehen.
Da sitzt Belacqua – so heißt der Protagonist – nun steif (er ist ja tot) und unbequem auf einem Zaun und grübelt über seinen Zustand nach, denn er erinnert sich genau an seinen Tod bei einer Operation. Entweder befindet er sich als Strafe für seinen belanglosen Lebenswandel in der Hölle oder er hat die Gelegenheit, seinem abgelaufenen Leben durch eine sinnvolle Handlung nachträglich noch eine gewisse Struktur zu verleihen.
Zuerst naht jedoch erst einmal die Versuchung in Gestalt einer Prostituierten. Danach tritt der monströse Lord Gall auf, der zwecks Erhaltung seines von einer männlichen Erbfolge abhängigen Grundbesitzes einen Sohn benötigt. Wegen seiner eigenen Impotenz soll Belacqua diese gute Tat an der Ehefrau des Lords vollziehen, was er erfolgreich tut – mit dem Ergebnis einer Tochter. Daraufhin begibt er sich an sein eigenes Grab, für dass der Totengräber Doyle zuständig ist. Belacqua gräbt sich mühevoll bis zu seinem Sarg, und damit endet die Geschichte. Er darf endlich richtig sterben.
Beckett stellt diesen Handlungsablauf jedoch nicht in einer konsistenten Abfolge von Aktivitäten und Dialogen dar, sondern löst sie auf in eine kafkaeske Folge metaphorischer, mit mythischen Gestalten bevölkerter Dialoge, deren Sinn sich logisch nicht erschließt. Man fühlt sich eher an nächtliche Träume erinnert, in denen sich die Personen, die Umgebungen und die Situationen unvorhersehbar und geradezu geisterhaft ändern. So wie in solchen Träumen die rationale Abfolge der Szenen sich in schemenhaft changierende Bilder und Assoziationen auflöst, geistern auch die Dialoge der Personen durch die Geschichte. Man darf hier nicht nach der typischen Folge von Behauptung, Widerspruch und Beweis suchen, sondern muss die einzelnen Äußerungen als Augenblicksempfindungen ohne logischen Zusammenhang sehen. Beckett passt hier durchaus in das Schema des Surrealismus, verzichtet dabei aber auf jeglichen satirischen oder gar karikierenden Humor. Aufklärung ist nicht seine Sache, sondern der Einfluss ungesteuerter Assoziationen und plötzlicher Empfindungen auf die Äußerungen der Protagonisten. Daher sollte man auch nicht versuchen, in die sinnlosen Dialoge einen konsistenten Sinn hineinzuinterpretieren. Zuweilen bilden kurze Dialogfolgen einen punktuellen Handlungssinn, der sich jedoch mit der nächsten Äußerung wieder auflöst und nur ein Chaos der Gedanken zurücklässt.
Dennoch vermittelt auch diese seltsame Geschichte einen einerseits beklemmenden, andererseits bewusstseinserweiternden Eindruck. Man fühlt sich hier nicht nur an Joyce´s „Ulysses“ sondern vor allem an Becketts „Godot“ und „Endspiel“ erinnert, um nur zwei zu nennen.
Das Buch ist im Suhrkamp-Verlag erschienen, umfasst 123 Seiten, von denen nur 60 auf die eigentliche Geschichte entfallen, und kostet24 Euro.
Frank Raudszus

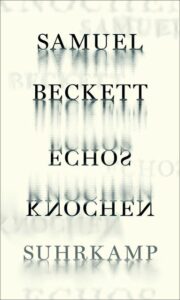
No comments yet.