Peter Handkes neuster Roman „Die Obstdiebin oder Einfache Fahrt ins Landesinnere“ lag bereits seit seinem Erscheinen im Jahre 2017 auf meinem Lesestapel, bis vor Kurzem ungelesen.
Die Diskussion um den Nobelpreis für Handke war nun der Anlass, mich endlich an „Die Obstdiebin“ heranzumachen.
Es war mir klar, dass es schwierig sein würde, unvoreingenommen an die Lektüre heranzugehen, denn zu heftig wurde die Kontroverse um Handke als Schriftsteller einerseits und als politische Person andererseits geführt. Dabei ging es im Wesentlichen um die Frage, ob man Autor und Werk trennen kann bzw. darf oder aber nicht. Die Erörterung soll hier nicht noch einmal aufgegriffen werden, da sind alle Argumente vorgetragen worden.
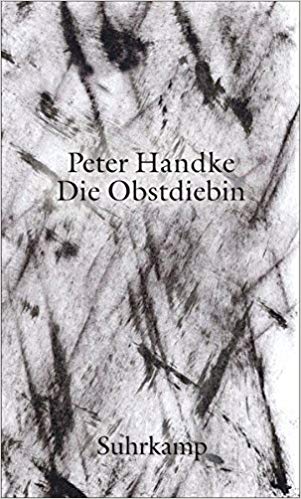
Nur so viel als Ausgangspunkt für meine neuerliche Handke-Lektüre: Um einer moralischen Verurteilung des Werks mit der des Autors zu entgehen, bin ich von der Frage ausgegangen, welche Inhalte, Botschaften, möglicherweise auch politische Positionen das einzelne Werk vermittelt, um von da aus das je einzelne Werk zu beurteilen, nicht aber den Autor.
Bevor ich die „Obstdiebin“ zur Hand nahm, habe ich drei Klassiker des Handke-Werks nach langer Zeit noch einmal gelesen: „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1972), „Wunschloses Unglück“ (1972) sowie „Die linkshändige Frau“ (1976).
In allen drei Erzählungen geht es um die innere Einsamkeit der Protagonisten, die zu menschlicher Nähe unfähig oder aber unwillig sind. Alle drei Erzählungen zeichnen sich durch eine kristallklare Sprache aus, die ganz offensichtlich an Kafka geschult ist – dazu lese man noch einmal den ersten Satz von „Die Angst des Tormanns …“ – und kein Wort zu viel enthält. Ein sehr distanzierter Erzähler führt seine Figuren vor wie ein analytischer Beobachter, zeigt deren Verhalten und Handeln, auch die Gedanken so emotionslos, dass er dem Leser allen Spielraum zur Interpretation lässt. Das macht in diesen frühen Texten die Faszination der Handke-Texte aus. So gelingt es ihm, den Leser miteinzubeziehen in die zunehmende Isolation seiner Figuren, der sie nicht mehr entkommen können oder wollen. Handke hält damit als junger Autor dem modernen Menschen einen Spiegel vor, und der Leser muss sich nach seiner eigenen Position in der Welt fragen.
Zwischen diesen drei Erzählungen und der „Obstdiebin“ liegen etwa 40 Jahre.
Was ist nun anders? Was ist ähnlich?
Auch die „Obstdiebin“ ist ein Roman vom „Allein-Sein“, besser gesagt vom „Allein-Gehen“, jedoch nicht von Einsamkeit. Aber nicht mehr Kafka scheint Pate zu sein, eher Adalbert Stifter mit seinem „Nachsommer“.
Handke selbst beginnt mit drei Zitaten: aus Wolfram von Eschenbachs „Willehalm“, aus der Bibel (Matthäus, 5, 41) und eins von dem Künstler Fritz Schwegler von Breech (1935 – 2014). Die Zitate lassen drei zentrale Themenkreise des Romans schon anklingen: Die Natur, die Beziehungen der Menschen zueinander und die Klage über fehlende Nächstenliebe. Aber es geht in diesem Roman auch um den Prozess des Erzählens selbst und entsprechend um die Subjektivität des Zeiterlebens.
Der Ich-Erzähler, offenbar in fortgeschrittenem Alter, macht sich eines Tage in der ersten Augustwoche auf den Weg, um von seiner Wohnung im Südwesten von Paris, in der Nähe von Versailles, zu seinem Ferienhaus in der Picardie zu fahren. Dieser Aufbruch bedeutet eine Übung in Langsamkeit für den Leser, denn der Erzähler beschreibt in aller Gemächlichkeit auch noch die kleinsten Schritte seiner Vorbereitungen des Aufbruchs. Nichts bleibt unbeachtet, auch die kleinsten Details wie ein gerissenes Schuhband, die Beschreibung des wohl eher verwilderten Gartens, das Verhältnis zu den Nachbarn, deren einer sich von der Stille dieses Anwesens gestört fühle. So erfährt allein der Weg zum Gartentor schon eine Zeitdehnung, die der Leser aushalten muss. Als dann auch der rostige Schlüssel abbricht, erwartet der Leser nun den Abbruch der Reise, aber es geht weiter, zunächst zu Fuß, dann mit der Bahn. Alle Verzögerung, alles Warten empfindet der Reisende selbst als angenehme Zeitdehnung, die seiner kontemplativen Grundhaltung zu entsprechen scheint.
Wir fahren mit dem Erzähler durch ganz Paris, beobachten die Mitreisenden, wundern uns über einen Stopp auf freier Strecke, bis seine Aufmerksamkeit auf eine schlafende junge Frau gelenkt wird, die „seine Obstdiebin“ sein könnte.
Von nun an verschiebt sich schleichend die Perspektive. Es vermischen sich Erinnerungen an die eigene Tochter mit der gerade erlebten Situation. Er selbst verlässt den Zug in Chars, offenbar um von dort zu seinem Feriensitz zu gelangen.
Ohne Übergang begegnen wir nun der tatsächlichen „Obstdiebin“, wie sie nach langer Abwesenheit wieder in Paris ist, aber auch schon wieder im Aufbruch, ebenfalls in die Picardie. Es bleibt unklar, wer hier eigentlich erzählt. Der Ich-Erzähler ist aus dem Bild verschwunden, erzählt wird in der dritten Person, mal aus der Perspektive des Vaters (ist er auch der vorherige Ich-Erzähler?), mal aus der Sicht der jungen Frau oder von einem nur beobachtenden Erzähler. Sie ist eine rastlos Reisende, hat gerade die Weiten Russlands bereist, offenbar ohne Karte und ohne bestimmtes Ziel, immer auf Entdeckungstour nach Menschen und Landschaften.
Schon als Kind war sie rastlos, verschwand manchmal längere Zeit, bis man sie irgendwo wiederfand, manchmal war sie gar nicht fern gewesen. Hier stellt die Erzählung, die sich mehr und mehr selbst erzählt, die Verbindung zu der Heiligenlegende des Alexius her, der nach jahrelanger Abwesenheit unerkannt in das Elternhaus zurückkehrt und seine Identität erst kurz vor seinem Tod preisgibt.
Den Namen „Obstdiebin“ erhielt sie in ihrer Kindheit von einem Nachbarn, aus dessen Garten sie auf abenteuerliche Weise eine Frucht entwendet hatte. Nicht negativ, sondern bewundernd war dieser Name gemeint, und so begleitet er die Frau durch ihr Leben wie auch ihr „Obstdiebestum“ selbst. Diese junge Frau unterscheidet sich von den durch Schminke und Aufmachung „maskierten“ jungen Frauen. Sie gibt eher das Bild einer an der Hippie-Generation orientierten jungen Frau, die sich um ihr Äußeres nicht schert, sich in langem Gewand mit einem großen Umhang auf den Weg macht.
Nun ist sie nach einem Treffen mit ihrem Vater unterwegs in die Picardie, es geht um die Wiederbegegnung mit der Mutter, der Weg ist ihre „Muttersuche“. Auch diese Reise verläuft, wie alle ihre anderen, planlos, im Zick-Zack. Schon der Beginn ist anders als geplant, sie schläft im Zug ein, fährt eine Station zu weit nach Norden bis in die neue Stadt Cergy-Pontoise im Speckgürtel von Paris.
Jetzt beginnt ihre dreitägige Fußreise, die einer Pilgereise ähnelt. Zunächst erlebt sie die Räume dieser neuen Stadt, die keine wirkliche Stadt mit einem gewachsenen Zentrum ist, sondern eine Ansammlung von Häusern und Straßen. Dennoch gelingt es ihr auch hier, Oasen der Ruhe zu finden und Menschen zu begegnen. Nur mit dem nötigsten Gepäck, ohne Plan durchquert sie diese Stadt, um dann die freie Landschaft des hügeligen Vexin zu erreichen.
Am Ende dieser Pilgerreise steht zwar die Wiederbegegnung mit der Mutter, dem Vater und dem Bruder, aber das ist nicht das Ziel, vielmehr ist der Weg das Ziel; die Wahrnehmung der Natur, die Begegnung mit Menschen, für einen Tag mit einem jugendlichen Wegbegleiter, die Rettung einer entlaufenen Katze. Die Orientierung ist intuitiv, sie kennt die ungefähre Richtung. Alles ist hier Entschleunigung, Bekenntnis zur Langsamkeit, zur Bedeutung des Augenblicks, entgegen allem modernen Effizienz- und Zweckmäßigkeitsdenken.
Am Ende begeht man dann das Fest der Familien-Reunion, von der Mutter vorbereitet. Sie steht als Bankerin für die andere Welt der Rationalität und des modernen Arbeitslebens, während der Vater als Hobby-Archäologe und Hobby-Historiker wie aus der Zeit gefallen wirkt, wie auch der Bruder, der ohne Ehrgeiz und Ziele am Waldrand mit Bauarbeitern in einer Holzbude lebt. So begegnen sich hier am Ende vier Menschen einer Familie, die keine Gemeinsamkeit haben außer der körperlichen Anwesenheit, vier Einzelgänger, die alle auf ihre Weise durch die Welt gehen und nach einer kurzen Begegnung wieder auseinanderstreben. „Muttersuche“ als ein Motiv für die Pilgerreise der Obstdiebin ist die Suche nach dem Verständnis der anderen Lebensform der Mutter, aber dazu kommt es nicht. Man nimmt sich wahr, aber ein wirkliches Interesse an den anderen Menschen der Familie besteht nicht.
Der Vater versucht es mit einer Ansprache, kommt aber aus dem Konzept, wenn er überhaupt eins gehabt hat, spricht unverständlich für die Familie und den Leser.
Was macht nun dieser merkwürdige Roman mit seinen Lesern?
Er lässt ihn verwirrt zurück, zwiegespalten in der Einschätzung. Da ist zum einen die Sprache, die ganz anders als in den frühen Erzählungen fast altväterlich behäbig daherkommt, bisweilen manieriert mit Wortwiederholungen und Wortneuschöpfungen, mit losen Satzenden, Aneinanderreihungen von unvollständigen Sätzen, Unterbrechungen des Erzählflusses durch direkte Ansprache an den Leser, Reflexion auf den Erzählprozess, weil die Geschichte auch ganz anders sein könnte.
Und trotzdem fasziniert Handke, seine Sprache hat immer noch einen Sog, auch wenn man sich über Eitelkeiten ärgert. Man legt das Buch dennoch nicht zur Seite.
Aber was ist die Botschaft? Muss man diesen Roman lesen? Das ist die Frage, denn er ist ein Plädoyer für anti-modernes Leben, für Rückzug aus dieser Welt, es klingt Verachtung für jene Menschen mit, die anders leben, die sich der Realität der Moderne stellen.
Vater und Tochter bilden eine Achse, die Tochter wird zur Missionarin seiner Weltsicht, denn sie wird gesehen, sie kommt mit den Menschen in Kontakt. Aber immer geht es nur um den jeweils individuellen, unmittelbar menschlichen Kontakt und um die Wahrnehmung der Natur. Dabei wird suggeriert, dass es noch eine unbedrohte Welt gibt, wenn wir sie nur gerade in den kleinen, scheinbar Unbedeutenden Erscheinungsformen wahrnehmen.
Können wir uns eine solche verklärte Sicht auf Menschen und Umwelt noch leisten?
Handke bleibt ein „Bewohner des Elfenbeinturms“, von dem aus er über die Menschen richtet, das hat er in den zahlreichen Interviews und Stellungnahmen zur Diskussion um seine Person anlässlich des Nobelpreises demonstriert.
Trotzdem ist auch reines Lesevergnügen mit „interesselosem Wohlgefallen“ erlaubt. Wer sich diese Auszeit nehmen will, der lese „Die Obstdiebin“.
Der Roman ist im Suhrkamp Verlag erschienen, hat 559 Seiten und kostet 34 Euro.
Elke Trost

No comments yet.