Nach den ersten Seiten dieses Anfang 2019 erschienenen Buches geht man davon aus, dass sich dieser Roman über die gesamte Nachkriegszeit bis heute erstreckt, zumal die heimliche Hauptperson unmittelbar nach dem Krieg zur Welt kommt und heute in den Siebzigern wäre. Man bereitet sich also auf ein reiches Personaltableau mit unterschiedlichen Orten, Charakteren und Entwicklungsstadien vor.
Doch weit gefehlt: Mosebach serviert ein Bild von gerade einmal zwei Straßen aus dem Frankfurter Westen und beschränkt dieses auch noch auf knapp zwanzig Jahre. Auch das Personal reduziert der Autor auf wenige zentrale Figuren, die in der Schubertstraße und der Mendelssohnstraße wohnen. Wichtig sind ihm die Lebensweise, die Weltsicht und die innere Befindlichkeit seiner Figuren, wobei er psychologisch in die Tiefe geht und auf jegliche Vordergründigkeit verzichtet.
Da sind die beiden angejahrten, ledigen Schwestern, die das Haus ihres Vaters nicht nur bewohnen, sondern wie ein kostbares Erbe bewahren und die Zeit buchstäblich im frühen 20. Jahrhundert erstarren lassen. Sie nehmen den verwaisten Säugling eines missratenen Neffen auf und erziehen ihn gemeinsam.
Einige Häuser weiter wohnt Dr. Eduard Has, Partner einer Immobiliengesellschaft, der das halbe Westend – teilweise noch Ruinen – gehört. Er ist noch jung, hat den Krieg in der Schweiz verbracht und sich von dort sowohl eine Frau als auch die Liebe zur Kunst mitgebracht. Ein großer Teil des Romans ist der umfassenden Kunstsammlung gewidmet, die Has mit Hilfe des Ex-Mannes seiner Frau in seinem Westend-Haus aufbaut. Dass er dem Basler Kunsthändler nicht nur die Bilder sondern auch die Frau abnimmt, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie. Romanliebhaber werden hier wieder große Verwicklungen ahnen, aber da liegen sie bei Mosebach falsch. Ihm geht es nicht um spannende Konflikte um Geld und Eros, sondern um die psychologischen Prozessen seiner mit menschlichen Schwächen durchaus gesegneten Figuren.
Has ist ein Genussmensch, der sich gerne gesellschaftlich präsentiert, wobei der Glanz nicht unbedingt von hart erarbeitetem geschäftlichen Erfolg herrühren muss. Das hatte schon seine geschäftstüchtige Mutter erkannt und ihm testamentarisch als führenden Partner einen knochentrockenen, asketischen Vetter vor die Nase gesetzt. Has – seine dickliche, aufgeschwemmte Figur ist symbolisch für seine Arbeitseinstellung – leidet zwar unter der Zurücksetzung, akzeptiert sie jedoch zähneknirschend und widmet sich seiner Kunst. Doch auch dort ist er trotz seines Geldes nicht die entscheidende Persönlichkeit, sondern beugt sich in allem den künstlerischen Anweisungen seines Händlers. Als seinen einzigen wirklichen Besitz betrachtet er seine Tochter Lilly, die er noch als Achtzehnjährige wie ein kleines Mädchen umsorgt und sie damit nervt.
Diese „Affenliebe“ ist insoweit verständlich, als seine Frau nach der Zeugung Lillys offensichtlich die erotischen Brücken zu ihm abgebrochen hat. Mosebach schildert sie als eine Art „Katze“, die ein warmes, sicheres Plätzchen – sprich: Wohlstand – benötigt und ansonsten ausschließlich für sich lebt. Dabei bedeuten ihr Geld und gesellschaftlicher Glamour gar nichts, sondern müssen lediglich als virtuelle Möglichkeit zur Verfügung stehen.
Nicht zuletzt aufgrund der ehelichen Situation verfällt Has ausgerechnet einer Mieterin, die er eigentlich wegen einer Beschwerde rügen sollte und die erst kürzlich von ihrem Mann verlassen und in dem Mietshaus in der Schubertstraße untergebracht wurde. Daraus gibt sich ein siebenjähriges Verhältnis, über das bald nicht nur die ganze Straße sondern auch die betrogene Ehefrau Bescheid weiß. Doch die nimmt den Dauerseitensprung ihres Mannes gelassen auf, weiß sie doch damit stets, wo er sich aufhält. Solange das Verhältnis nicht zum Stadtgespräch wird, ist es ihr gleichgültig, wenn nicht gar recht.
Parallel zu dem ambivalenten Lebensmodell des Eduard Has schildert Mosebach Kindheit und Jugend des kleinen Waisen im Haus der beiden Schwestern. Stück für Stück erschließt er sich das Westend, erst per Tretroller und dabei über die Kriegsruinen staunend, später in nächtlichen Wanderungen zu zweifelhaften Bierlokalen. Doch im Grunde genommen folgt er dem großmütterlichen Erziehungskonzept seiner Großtanten. Da die hübsche Lilly seine Klassenkameradin wird, ist eine erste Verliebtheit unumgänglich, ohne dass Alfred, so sein Name, sie als solche erkennt. Außerdem ist der Has’sche Haushalt für Alfred unerreichbar. Da Mosebach diesen Jungen in seinem kindlich-jugendlichen Reifeprozess so detailliert wie glaubwürdig beschreibt, liegt ein autobiographische Hintergrund nahe. Dafür spricht auch das Geburtsjahr des Autors (1951). Nur Alfred und Eduard werden in dieser Detailtiefe „von innen heraus“ dargestellt; alle anderen Figuren werden eher von außen, sozusagen aus der Sicht des allwissenden Erzählers, beschrieben.
Zu letzteren gehört auch Eduards ehemaliger Studienfreund aus Österreich, der als Architekt die Galerie für die Kunstsammlung gestaltet. Ihn zeichnet Mosebach als „Herrenreiter“-Typus, der sich als Avantgarde-Architekt inszeniert und zu jedem Thema nicht nur kompetente, sondern auch maßgebliche Meinungen zu äußern weiß. Er weiß seine hochstapelnden Sätze so gezielt zu platzieren, dass jeder von ihm überzeugt ist. Dass der von Eduard bewunderte Alleskönner als Architekt gescheitert ist, weiß nur Eduards Partner, der knochentrocken ein paar Erkundigungen eingezogen hat. Und das ererbte Landhaus hat der Selbstdarsteller nicht aus Gründen der Authentizität und des familiären Respekts, sondern aus purer Geldnot im renovierungsbedürftigen Vorkriegszustand belassen. Doch solche doppelbödigen Verhältnisse erkennt Eduard nicht – oder will sie nicht erkennen, weil sie sein Weltbild beschädigen.
Am Ende verzichtet Mosebach auf beide für Familienromane typischen Wendungen: die Tragödie und das Happy-End. Und doch beginnt Eduards Stern dramatisch zu sinken, als die Immobilienfirma in einen finanziellen Engpass gerät und die Kunstsammlung plötzlich zur Verfügungsmasse wird. Und auch sein Privatleben steuert auf eine Katastrophe zu, als er aufgrund wachsender Probleme die Übersicht verliert und sich zu einer Kurzschlusshandlung verleiten lässt.
Das letzte von sieben Kapiteln, „Tod“ übertitelt, bezieht zwar diesen Titel sachlich von dem Ableben einer der beiden älteren Schwestern, lässt aber gleichzeitig eine Reihe weiterer Lebensentwürfe sterben und erfüllt damit die düstere Prophezeihung des Titels.
Erstaunlich erscheint lange Zeit der konsequente Verzicht auf jegliche historische Einordnung dieses Romans. Das beginnt damit, dass auf 900 Seiten keine Jahreszahl genannt wird, setzt sich fort in dem Fehlen jeglicher innen- oder außenpolitischen Ereignisse der fünfziger und sechziger Jahre und wird durch den Verzicht auf jeglichen Politiker- oder Prominentennamen dieser Zeit bestätigt. Der Roman lebt buchstäblich in der Enklave des Westends mit knappen Ausflügen zum Osthafen und in die Steiermark.
Auch die Vorkriegs- und Kriegszeit wird elegant ausgeklammert, wohl, um von vornherein den Vorwurf fehlender Vergangenheitsbewältigung in einem Nachkriegsroman zu entkräften. Eduard Has hat vor dem Krieg im Ausland studiert und während des Krieges in der Schweiz gelebt, was ihn von vornherein von jeglicher politischen Belastung befreit. Die beiden älteren Damen bergen in ihrer Naivität kein politisches Potential, und die anderen Figuren sind eher zweitrangig, abgesehen von dem jungen Alfred, der jedoch erst nach dem Krieg zur Welt kommt.
Gerade das Aussparen von Jahreszahlen lässt es möglich erscheinen, dass Alfred im Geburtsjahr des Autors zur Welt kommt. Damit eröffnet sich die Interpretation dieses Romans als Aufarbeitung der eigenen Kindheit und Jugend. Das würde auch den Verzicht auf die große und kleine Politik erklären, denn die interessiert ein aufwach(s)endes Kind bekanntlich überhaupt nicht. Die Figur des Eduard Has könnte dann auch der Biographie des Autors entnommen worden sein, wobei Mosebach wahrscheinlich – außer den notwendigen „Verfremdungen“ – auch das Verstreichen einer gewissen Zeit nach dem Tode des Vorbilds beachtet hat.
Was diesen Roman auszeichnet, ist nicht das gesellschaftliche oder gar politische Bild einer ganzen Epoche, sondern die weit ausholende und bis in jede Verästelung der seelischen und geistigen Befindlichkeiten reichende Beschreibungskunst. Lange, wohlgeformte Sätze geben die Gedankengänge der Protagonisten klischeefrei und oftmals mit feiner Ironie wieder, und der Fluss der Formulierungen erschafft eine ganz eigene, in sich geschlossene Welt von Erinnerungen, Sehnsüchten und Ängsten, wie sie nur große Romanciers mit hoher Sprachpotenz erschaffen können.
Das Buch ist im Rowohlt-Verlag erschienen, umfasst 897 Seiten und kostet 20 Euro.
Frank Raudszus

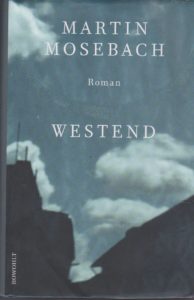
No comments yet.