Im letzten Jahrzehnt hat sich vor allem in den westlichen Ländern das Phänomen der „Identität“ ausgebreitet, das in Europa direkt in dem Begriff der „Identitären“ auftaucht und sowohl in Trumps USA als auch in verschiedenen westeuropäischen Ländern in den jeweiligen populistischen Parteien und expliziter Fremdenfeindlichkeit seinen Niederschlag findet. Francis Fukuyma, der nach 1990 mit dem seiner Meinung nach missverstandenen Satz über das „Ende der Geschichte“ Berühmtheit erlangte, nimmt sich jetzt dieses Phänomens an und versucht, es aus philosophischer und historischer Sicht zu erklären.
Fukuyama holt weit aus und beginnt mit dem griechischen Begriff „Thymos“, der soviel wie „Stolz“ oder „Wunsch nach Anerkennung“ bedeutet. Damals hatten nur Krieger diesen Anspruch, weil sie ihr Leben für die Gemeinschaft einsetzten. Den Gedanken einer allgemeinen, unantastbare Menschenwürde gab es nicht. Fukyama weist jedoch gleich zu Beginn darauf hin, dass es schon in der Antike zwei Ausdrucksarten dieses Anerkennungsanspruchs gab: die „Isothymia“, die einen gleichwertigen Würdeanspruch aller Menschen bezeichnet, und die „Megalothymia“, die für einen exklusiven Würdeanspruch einzelner Individuen oder Gruppen steht. Für letztere nennt er – aus guten Gründen – keine aktuellen Beispiele, aber die dürften sich leicht finden lassen. Sie führt zwangsläufig zu Konflikten.
Der menschlichen Seele wurden bereits im Altertum zwei widerstreitende Charakteristiken zugeschrieben: die Vernunft und das Begehren. In einem idealen Menschen überwindet die Vernunft das Begehren nach einem inneren Prozess der Reflexion und Läuterung. Martin Luther unterschied das äußere vom inneren Selbst des Menschen, das seine eigentliche Identität ausmacht. War diese Definition noch weitgehend auf das religiöse Verhalten ausgerichtet und implizierte die Ausrichtung des Menschen nach dem inneren Selbst, d.h. seinen ureigensten (spirituellen) Bedürfnissen, so entwickelte sich daraus mit der Aufklärung der Begriff der unveräußerlichen Menschenwürde, wie Rousseau und nach ihm Hegel und andere sie definierten.
Für die Gegenwart führt Fukuyama als Beispiel den Gemüsehändler in Tunesien an, der sich wegen der existenziellen Bedrohung seiner Menschenwürde öffentlich verbrannte und damit die „Arabellion“ auslöste. Im geopolitischen Bereich nennt er die Kontraposition Russlands gegenüber dem Westen, die sich explizit auf die Missachtung Russlands als Großmacht nach dem Zusammenbruch des Sozialismus bezieht. Ausgehend von diesen Beispielen kommt Fukuyama zu dem Schluss, dass der Anspruch auf (gleiche) Würde mit dem Anspruch auf persönliche Freiheit kollidiert, denn letztere garantiert die freie Entfaltung des Individuums und impliziert damit unterschiedlich erfolgreiche Lebensläufe und die darauf zurückzuführende Anerkennung.
Der reine Individualismus, wie er im Westen lange propagiert wurde, macht eine funktionierende Gesellschaft aufgrund der zunehmend sich verschärfenden Konkurrenz um Anerkennung unmöglich. Der Kollektivismus dagegen, der die unterschiedslose Anerkennung einfordert, denunziert erst jegliche individuelle Anstrengung, da sie latent zu höherer Anerkennung führt, und endet letztlich in vollständiger Repression des Individuums. Diese Entwicklung ließ sich sehr gut am real existierenden Sozialismus nachvollziehen und ist auch heute in Ansätzen in kollektivistisch-autoritären Systemen zu beobachten. Die Unterdrückung der individuellen Antriebe führt letztlich zu wirtschaftlichem Abstieg und Verarmung.
Im 20. Jahrhundert sieht Fukuyama die Entstehung einer „Demokratisierung“ der Würde. Dabei verlaufen die Stränge der individuellen und der kollektiven Würde parallel. Die aufkommende Therapeutik betrachtet ausschließlich den individuellen Aspekt, den sie stets im Gegensatz zur Gesellschaft sieht, während verschiedene politische Ströme den kollektiven Aspekt betonen. Dabei zeichnen sich sowohl die sozialistische als auch die multikulturelle Variante durch eine Geringschätzung des Individuums aus. Beide enthalten inhärent ein „megalothymianisches“ Element, da sie sich den konkurrierenden Gesellschafts- und Religionssystemen gegenüber für überlegen halten. Fukuyama diskutiert diesen Effekt nicht weiter, wahrscheinlich, um kein Öl ins Feuer zu gießen, er schwingt jedoch in seinen Ausführungen mit. Seine Behauptung, dass die Radikalisierung des Islams eigentlich eine Islamisierung eines sozial bedingten Radikalismus sei, ist nicht schlüssig, da sich die Selbstmordattentate – vor allem gegen eigene Glaubensgenossen! –
nicht zwangsläufig aus einem Protest gegen mangelnde soziale Anerkennung herleiten lassen.
Die Entwicklung von Demokratien westlichen Zuschnitts schließlich lässt sich für Fukuyama nur aus einer bereits bestehenden nationalen Identität herleiten, da nur sie die Organisation größerer Gemeinschaften ermöglicht. Man kann diese Behauptung relativ leicht an dem verspäteten Entwicklung demokratischer Strukturen in dem über Jahrhunderte in kleinste Fürstentümer aufgesplitterten deutschen Siedlungsgebiet nachvollziehen. In England und Frankreich dagegen erlaubte die wesentlich homogenere „nationale“ Struktur auch eine frühere Entwicklung der Demokratie. Mit „national“ meint Fukuyama dabei nicht die heute übliche Identifikation mit dem ideellen Überbau sondern lediglich die strukturellen – geographischen, sprachlichen und auch ethnischen – Voraussetzungen für eine Gemeinschaft.
Im letzten Kapitel stellt Fukuyama Lenins alte Frage „Was tun?“ neu und setzt sie gleich als Titel ein. Sein Handlungsvorschlag überrascht nicht, verlangt er doch eine „Bekenntnis“-Identität als Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Dieses Bekenntnis muss eine ausgewogene Mischung aus freiheitlichen und gemeinschaftlichen – sprich: sozialen – Grundsätzen enthalten, um eine möglichst große Zahl unterschiedlicher individueller Lebensentwürfe zu integrieren. Einer religiösen oder gar ethnischen Grundlage erteilt er wegen ihrer megalothymianischen Tendenzen eine deutliche Absage. Das Problem dabei ist, dass er damit die liberalen Grundwerte der westlichen Demokratien fortschreibt, die von den bekannten ethnischen und religiösen Gruppen bekanntlich vehement abgelehnt werden. Das Fazit daraus lautet damit trotz allen ehrlichen Engagements: „Im Westen nichts Neues“.
Das Buch ist im Verlag Hoffmann und Campe erschienen, umfasst 237 seiten und kostet 22 Euro.
Frank Raudszus

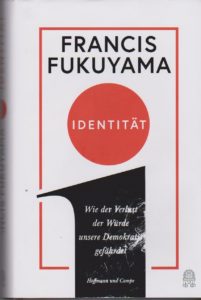
No comments yet.