Dieses ist ein anderer Italien-Reiseführer. Er ist bestimmt durch den Weg der trauernden Erzählerin zu sich selbst und zu den Menschen, die sie verloren hat. Als Leser und Leserinnen reisen wir mit ihr und sehen Orte und Landschaften durch ihre melancholische Brille. Die Erzählerin reist nach dem Tod ihres Mannes M. – damit ist sie offenbar identisch mit der Autorin, deren Mann Martin vor nicht allzu langer Zeit gestorben ist – nach Italien. Das tut sie jedoch nicht zur üblichen Zeit, in der man touristische Italienreisen unternimmt. Sie reist im Winter in den kleinen Ort Olevano Romano in den Bergen östlich von Rom. Hier erlebt sie ein Italien, das sich dem Besucher verschließt, das von einer trostlosen Alltäglichkeit geprägt ist. Das genau scheint die Erzählerin zu suchen, um sich ihrer Trauer zu stellen und zu lernen, mit dem Verlust des geliebten Menschen umzugehen.
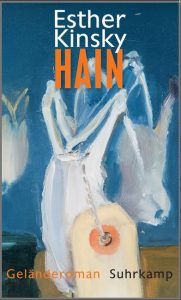 Mit dem Auto unternimmt sie Fahrten in die Umgebung. Ziel sind meist die Friedhöfe in kleinen Ortschaften. Sie entdeckt die unterschiedlichen Grabstätten, die Fächer in den Columbarien und die Erdgräber. Sie läuft über die Friedhöfe, liest Namen, stellt sich vor, welche Menschen und welche Lebensgeschichten sich hinter diesen Namen verbergen mögen. Einem Namen geht sie konkret nach, um herauszufinden, dass es sich um eine
Mit dem Auto unternimmt sie Fahrten in die Umgebung. Ziel sind meist die Friedhöfe in kleinen Ortschaften. Sie entdeckt die unterschiedlichen Grabstätten, die Fächer in den Columbarien und die Erdgräber. Sie läuft über die Friedhöfe, liest Namen, stellt sich vor, welche Menschen und welche Lebensgeschichten sich hinter diesen Namen verbergen mögen. Einem Namen geht sie konkret nach, um herauszufinden, dass es sich um eine
ganz alltägliche Existenz und einen alltäglichen Tod gehandelt hat, dass aber auch um diesen Menschen getrauert wurde. Friedhöfe sind für die vii, nicht für die morţi, deren Gebeine dort liegen.
Einen Ausflug nach Rom und Ostia bricht sie ab, die Geschäftigkeit und der Lärm der Großstadt verstören sie. Obwohl sie mit dem Verstorbenen M. nie in Italien gewesen ist, fühlt sie sich ihm nah. In scheinbar unbedeutenden Situationen wird die konkrete Erinnerung an ihn wach, wie etwa, als sie ihr Auslöserkabel für die Kamera nicht finden kann. Er hatte es seinerzeit während einer anderen Reise bei einem Händler aus einem Kabel-Knäuel herausgefischt. Dieses Italien ist offenbar der Ort, an dem sie ihre Seele heilen kann als Ort, den sie seit ihrer Kindheit und Jugend von den alljährlichen Fahrten mit der Familie kennt.
So ist denn auch der zweite Teil geprägt von diesen Familienfahrten. Der Tod und die Beerdigung des Vaters sind Anlass für die Erzählerin, diese Italien-Erinnerungen noch einmal Revue passieren zu lassen. Der Vater, immer auf der Suche nach etruskischen Nekropolen und allem Wissen über die Etrusker, ordnet die Bedürfnisse der Familie seinem Wissensdrang unter. Es sind also nicht die typischen Urlaube mit Strand und Meer, eher Forschungsreisen, bei der die Familie mit ihren Bedürfnissen in Kauf genommen wird. Dabei fällt die fast autistische Haltung des Vaters auf, der alleine
stundenlange Wanderungen durch die Städte unternimmt, um sich danach schweigsam in das Feriendomizil zurückzuziehen, offenbar getrieben von Sehnsüchten, die er seiner Frau und seinen Kindern nicht mitteilen kann oder will.
Neben den Nekropolen der Etrusker faszinieren den Vater die Gemälde Fra Angelicos, insbesondere das kostbare Blau in dessen Engelsdarstellungen.
Das erkennt erst die erwachsene Tochter, als Kind nimmt sie das Verhalten hin, ohne es verstehen zu können. Besonders ist ihr ein langer Schwimmausflug des Vaters in Erinnerung. Er war eines Tages weit ins Meer hinausgeschwommen und erst nach Stunden, als die Mutter und die Bademeister schon in großer Sorge waren, aus einer ganz anderen Richtung zurückgekehrt.
Als Erwachsene trifft sie ihren Vater kurz vor seinem Tod in Triest. Er hat inzwischen seinen Beruf aufgegeben hat und arbeitet als Fremdenführer in Italien, ist oft wochenlang nicht zu Hause. Es ist ihr letztes Gespräch mit ihm. Ihr ist es unangenehm, sich ihren Vater als servilen Begleiter von Reisegruppen vorzustellen. So bleibt das Gespräch schwierig, Nähe will sich nicht einstellen. Gegen Ende des Gesprächs legt ihr der Vater Ravenna ans Herz, besonders solle sie sich das Hafenbild in Sant‘ Apollinare Nuovo ansehen. Von daher ergibt sich die Verbindung zur dritten Station dieses Romans. Die Erzählerin macht sich auf eine Reise Richtung Ravenna. Zwischenstationen sind Ferrara und Comachhio. Auch dieses Mal ist es Winter, die Zeit nach Weihnachten. Ferrara ist kalt, düster und unwirtlich. Die Wasserlandschaft um Comachhio ist geprägt von der Ärmlichkeit der Bewohner und der Trostlosigkeit der verlassenen Lidi. In Comacchio kommt die Erzählerin auf einem etwas heruntergekommenen Bauernhof unter. Der Besitzer nimmt sie mit auf eine Fahrt entlang den Wällen um das große Wasserbecken von Comacchio. Er trauert den alten Zeiten nach, als dort noch die Fischerei blühte. Durch die Trockenlegung großer Feuchtgebiete im Po-Delta haben die meisten ihre Arbeit verloren. Viele wollen nur weg. Das liegt wie eine Lähmung über den Menschen. Auf ihren Wanderungen durch die Landschaft beobachtet die Erzählerin die Wasservögel, die Flamingos beherrschen das Bild. Sie ist überrascht, als sich beim Auffliegen deren schwarz-rotes Untergefieder zeigt, das in starkem Kontrast zu dem Grau-Rosa des Deckgefieders steht, ein Hinweis, dass sich unter der grauen Oberfläche des Lebens oft mehr verbirgt, als es den Anschein hat.
Das eigentliche Ziel der Reise ist Ravenna, wo die Erzählerin Sant‘ Apollinare Nuovo aufsucht, um das Hafenbild zu finden, von dem ihr Vater gesprochen hat. In dem Wandfries direkt am Eingang findet sie es: drei Schiffe, eins mit gesetztem Segel, vor strahlendem Blau, daneben die Stadtmauern von Ravenna, ein Bild, das sich in jedem Bildband über Ravenna findet. Die Erzählerin ist überzeugt, dass ihr Vater dieses Bild
nicht gemeint haben kann. Als sie sich umdreht, sieht sie auf dem gegenüberliegenden Fries, genau gegenüber dem berühmten Hafenbild, ein weiteres Hafenbild, diesmal ohne Schiffe, nur ein lichtes blaugrünes Nichts, auf dieser Wasserfläche nur vage Andeutungen von Booten oder einer Insel, darüber über einem Mauerrahmen drei kleine weiße Figuren, alles mit dem unbestimmten Ausdruck von Licht, Weite und Freiheit. Das muss der Vater
gemeint haben. Das muss seinem Lebensgefühl, seinem einsamen Autismus und seinen Sehnsüchten nach unbegrenzter Freiheit entsprochen haben. Dieses Bild findet sich in keinem Bildband.
Dazu passt dann der Epilog, die Betrachtung der „Lamentatio“ des Heiligen Franziskus, das sich in der Predella der Darstellung des Jüngsten Gerichts befindet. Links sieht man die Begegnung von Domenicus und Franziskus, in der Mitte die Beweinung. Beide Bilder enthalten wie auch das Jüngste Gericht das hoffnungsfrohe Blau Fra Angelicos. Diese Tafeln finden sich in vielen Bildbänden. Nur die rechte Tafel enthält kein Blau, stattdessen
ein trauriges, tristes Braun. Gibt es doch keine Hoffnung? Dieses Bild findet sich nirgends.
Esther Kinskys Roman ist ein Roman über die Trauer, über die Gewissheit, den geliebten Menschen für immer verloren zu haben. Zwar gibt es die Erinnerung, auch die Träume, die den geliebten Menschen ganz nahe sein lassen. Aber Trost gibt es nicht.
Der Roman besticht durch die wunderbare, klare Sprache, die genaue Beobachtung von Städten und Menschen einerseits, von Natur und Tieren andererseits. Der melancholische Ton führt nicht zu Traurigkeit, sondern zu stiller Begleitung der trauernden Erzählerin und ihren neuen Blick auf ein trauerndes Italien. War auch der Blick des Vaters ein trauernder?
Der Roman ist im Suhrkamp-Verlag erschienen, umfasst 284 Seiten und kostet 24 Euro.
Elke Trost

No comments yet.