Eine umfangreiche Darstellung der Zeit vor und nach dem „Wiener Kongress“.
Der Titel dieses Buches suggeriert, dass es hier um das Jahr 1815 geht, ist jedoch eindeutig auf den Marketingeffekt dieses Jubiläums zurückzuführen.Im Grunde genommen beschreibt der amerikanische Historiker mit polnischen Wurzeln die Zeit von 1812 bis 1815 und – in einer Art Epilog – die Auswirkung des Wiener Kongresses auf die Jahrzehnte danach.
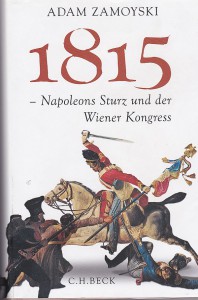 Als Napoleon Ende 1812 nach der Katastrophe in Russland nach Paris zurückkehrte, erkannten seine Zwangsverbündeten Österreich und Preußen die einmalige Chance, sich im Verein mit dem rache- und expansionslüsternen Russland von dem französischen Usurpator zu befreien. Das gelang zwar in der Völkerschlacht bei Leipzig im Herbst 1812, ermöglichte aber den Franzosen, sich halbwegs geordnet nach Westen zurückzuziehen (siehe hierzu auch „1813“ von Andreas Platthaus), da die Österreicher im Westen Deutschlands kein politisches Vakuum als Einfallstor für Preußen schaffen wollten. Schon damals zeigte die Allianz gegen Napoleon erste Risse. Nachdem dank des preußischen und russischen Drucks die vereinten Heere Napoleon bis nach Paris verfolgt – auch hier wollte der österreichische Kanzler Metternich einen „Durchmarsch“ der Russe durch Deutschland verhindern! – und dort endgültig geschlagen hatten, stellte sich die Frage einer neuen europäischen Nachkriegsordnung, denn Napoleon hatte die aus Sicht der Monarchen bewährte Ordnung des „ancien régime“ weitgehend beseitig und politisch modernisiert. Obwohl Napoleon bereits im Frühjahr 1814 nach Elba verbannt worden war, konnte man sich aus vielerlei taktischen und politischen Gründen nicht auf einen schnellen Beginn eines solchen Kongresses einigen, da jede der beteiligten Mächte noch ihre Position durch die „Macht des Faktischen“ festigen wollte, bevor sie bei Verhandlungen eventuell wieder in Frage gestellt würde. So begann denn der Kongress erst im Herbst 1814, wobei Metternich es mit einiger politischer Raffinesse erreicht hatte, in Wien seinen Heimvorteil auszuspielen.
Als Napoleon Ende 1812 nach der Katastrophe in Russland nach Paris zurückkehrte, erkannten seine Zwangsverbündeten Österreich und Preußen die einmalige Chance, sich im Verein mit dem rache- und expansionslüsternen Russland von dem französischen Usurpator zu befreien. Das gelang zwar in der Völkerschlacht bei Leipzig im Herbst 1812, ermöglichte aber den Franzosen, sich halbwegs geordnet nach Westen zurückzuziehen (siehe hierzu auch „1813“ von Andreas Platthaus), da die Österreicher im Westen Deutschlands kein politisches Vakuum als Einfallstor für Preußen schaffen wollten. Schon damals zeigte die Allianz gegen Napoleon erste Risse. Nachdem dank des preußischen und russischen Drucks die vereinten Heere Napoleon bis nach Paris verfolgt – auch hier wollte der österreichische Kanzler Metternich einen „Durchmarsch“ der Russe durch Deutschland verhindern! – und dort endgültig geschlagen hatten, stellte sich die Frage einer neuen europäischen Nachkriegsordnung, denn Napoleon hatte die aus Sicht der Monarchen bewährte Ordnung des „ancien régime“ weitgehend beseitig und politisch modernisiert. Obwohl Napoleon bereits im Frühjahr 1814 nach Elba verbannt worden war, konnte man sich aus vielerlei taktischen und politischen Gründen nicht auf einen schnellen Beginn eines solchen Kongresses einigen, da jede der beteiligten Mächte noch ihre Position durch die „Macht des Faktischen“ festigen wollte, bevor sie bei Verhandlungen eventuell wieder in Frage gestellt würde. So begann denn der Kongress erst im Herbst 1814, wobei Metternich es mit einiger politischer Raffinesse erreicht hatte, in Wien seinen Heimvorteil auszuspielen.
Zamoyski beginnt jedoch – wie bereits erwähnt – Ende 1812, beschreibt die damalige geopolitische Situation in Europa im Detail und stellt die Protagonisten dieses historischen Spektakels mit ihren Interessen, Schwächen und Ängsten vor. Napoleon musste immer vorwärts gehen und siegen, da er genau wusste, dass ein Misserfolg sofort die Royalisten und Vertreter des „ancien régimes“ gegen ihn in Stellung bringen würde. Zar Alexander I. sah sich nach seinem Sieg über Napoleon als Retter der Menschheit und wollte die ganze (europäische) Welt mit einer militärischen und geistig-moralischen Expansion beglücken. Preußen litt – neben seinen Minderwertigkeitskomplexen nach den diversen Niederlagen gegen Napoleon – unter seiner für eine Großmacht zu geringen Größe sowie einem zersplitterten Staatsgebiet, das es abzurunden galt. Österreichs Metternich sah durchaus die Schwäche seines Vielvölkerstaates und die Begehrlichkeiten vor allem Russlands, erkannte aber auch die Gefahr eines erstarkenden Preußens. England schließlich hatte lange Zeit als einziges Land dem Allmachtsanspruch Napoleons widerstanden und wollte jetzt auf jeden Fall die Nachkriegsordnung mitbestimmen. Seine Seemacht und finanziellen Mittel stellten dabei gegenüber den ausgebluteten Kontinentalmächten ein wirksames Druckmittel dar. Dabei ging England mit dem Ziel eines starken Frankreichs in die Konferenz, um ein Gegengewicht gegen Russland herzustellen, das nicht nur nach Westen drängte, sondern England auch in Asien als Konkurrent gegenüberstand. In dieser Sicht unterstützten sie die Österreicher aus ähnlichen Gründen, während die Preußen sich fast schon in einer Art Nibelungentreue vor Russland stellten.
Alle diese Beweggründe und Randbedingungen stellt Zamoyski detailliert dar, wobei er nicht die abstrakte Staatsraison oder offizielle Politik des jeweiligen Landes sondern ihre Vertreter in den Mittelpunkt stellt. Dadurch gewinnt das Buch individuelle Züge und zeigt, dass es immer wieder Individuen sind, die das Geschehen bestimmen, und nicht abstrakte Ideen. Das Misstrauen, die Machtgier und die Eitelkeiten der Beteiligten schlagen sich dabei unmittelbar in ihrem Auftreten und in ihren Handlungen nieder. Dabei zeigt sich deutlich der Unterschied zwischen den Monarchen und ihren politischen Vertretern am Verhandlungstisch. Erstere glänzen durch Inkompetenz, Selbstüberschätzung und Eitelkeit – allen voran Zar Alexander -, letztere müssen die Politik im Namen ihrer Herrscher und Nationen vertreten und hart verhandeln. Dabei sind auch sie nicht frei von Eitelkeiten, Vorurteilen und nationaler wie persönlicher Machtgier. Vor allem denken sie nie an das so oft beschworene „Wohl der Völker“ sondern nur an die Interessen ihrer Monarchien, das heißt, deren Machterhalt und -erweiterung. Dabei glauben sie selbst, im Sinne der Völker zu handeln. Friede ist für die Politiker und Monarchen – letztere kann man nicht als Politiker in heutigem Sinne verstehen – Ruhe und Ordnung, und sei es die eines Friedhofes.
Zamoyski geht nach einem streng chronologischen Konzept vor, das er höchstens verlässt, um kurz die historischen Hintergründe einer bestimmten Situation zu erklären. Dabei verzahnt er die Handelnden der einzelnen Nationen auf einer fast täglichen Basis und verzichtet auch auf eine Strukturierung nach strategischen und historischen Gesichtspunkten der einzelnen Nationen. Diese kommen, soweit sie für den Gang der Handlung wesentlich sind, als Teil der Verhandlungen zum Ausdruck. So diskutiert er nicht Bedeutung und Randbedingungen der englischen Seegeltung, sondern erwähnt diese lediglich in Gestalt entsprechender Kommentare der anderen Kongressteilnehmer oder in kurzen Kommentaren. Ähnliches gilt für die kolonialen Aktivitäten der Franzosen, Entstehung und Wachstum Preußens oder die geopolitischen Strategien der Russen. Das ist jedoch nicht unbedingt als Schwäche des Buchs zu betrachten. Zamoyski will die Zeit und die Bedingungen des Wiener Kongresses beschreiben und keine weltpolitische Analyse des frühen 19. Jahrhunderts liefern. Dazu scheint ihm ein narrativer Stil am besten geeignet zu sein – nicht ganz zu Unrecht.
Zu diesem „narrativen Stil“ gehören auch die fast ausufernden Beschreibungen der privaten Aktivitäten aller Kongressbeteiligten. Er selbst zitiert die Bemerkung eines Zeitgenossen, Wien sei zur Zeit des Kongresses ein großes Bordell gewesen, wobei dies nicht etwa nur für Soldaten und subalterne Ränge sondern vor allem für die führenden Köpfe gilt. Fast alle Verhandlungsteilnehmer, von den Monarchen bis zu den Sekretären, führten ein intensives bis ausschweifendes erotisches Leben, das durch die Bereitwilligkeit führender adliger und bürgerlicher Damen der österreichischen Gesellschaft erleichtert wurde. Zar Alexander machte vor keinem Rock halt, wobei sein Erfolg bei den Damen wegen seiner linkischen Art und seiner nicht gerade sprichwörtlichen Schönheit als fraglich gilt. Dafür rührte er mit seinem visionären, religiös gefärbten Auftritt als Weltenretter eher die schöngeistigen Gefühle vieler Frauen. Metternich teilte sich unfreiwillig seine „unsterbliche“ Geliebte mit einigen schneidigeren und jüngeren Konkurrenten und litt derart unter Eifersuchtsattacken, dass er selbst in kritischen Verhandlungssituationen nur seine erotischen Probleme im Kopf hatte. Der Franzose(!) Talleyrand, der es dank der Engländer und seiner geschickten Taktik zu einem gleichwertigen Verhandlungspartner gebracht hatte, verzehrte sich zur Hälfte seiner Zeit in einer Beziehung zu einer jungen Frau, und selbst die trockenen und nüchternen Engländer waren gegen die Verlockungen des Wiener Freizeitangebots nicht gefeit. Hardenberg, der Vertreter Preußens, war für solche Eskapaden wohl schon etwas zu alt, doch Wilhelm von Homburg, den die deutsche Geschichte eher als seriösen Mann kennt, hatte ebenfalls seine Geliebte in Wien. Dass alle diese ehrenwerten Herrn verheiratet waren und nicht im Traum an eine Scheidung dachten, versteht sich von selbst, und teilweise waren die Ehefrauen sogar in Wien anwesend und mussten die Amouren ihrer Männer erdulden. All das geschah quasi öffentlich, und die Vertreter der großen Mächte machten sich durch ihre oftmals geradezu pubertären Affären in der Öffentlichkeit lächerlich, was ihnen jedoch nichts auszumachen schien. Doch für die weitere politische Entwicklung war dies ein Fingerzeig, denn das einfache Volk hatte mit der unbeschränkten Autorität der Herrscher und ihrer Vertreter stets unbewusst ein zumindest in der Öffentlichkeit vorbildhaftes Auftreten verbunden, und die Enttäuschung dieser Erwartungshaltung führt zu zunehmender Distanz zu dem herrschenden autoritären System. Die Volksaufstände von 1830 und 1848, um nur zwei Beispiele zu nennen, waren eine fast zwangsläufige Folge.
Wenn auch die ausführliche Schilderung der privaten Ausschweifungen zur Ergänzung der gesellschaftspolitischen Atmosphäre durchaus dienlich ist, übertreibt es Zamoyski bisweilen, wenn er die Geschichte jeder einzelnen Beziehung bis in die Kräche, Enttäuschungen, Versöhnungen und den Tratsch und Klatsch nachzeichnet. Hier hätte der Autor durchaus den Stoff straffen und dafür etwas mehr politische und soziale Tendenzen herausarbeiten können.
Der Titel suggeriert weiterhin, dass die Schlacht von Waterloo im Juni 1815 einen zentralen Platz einnimmt. Das ist jedoch mitnichten der Fall. Napoleons Wiederkehr und die hundert Tage seiner zweiten Herrschaft nehmen gerade einmal fünfzig Seiten in Anspruch, von denen die Schlacht selbst nur eine Seite benötigt. Da der Wiener Kongress zu diesem Zeitpunkt schon seit zwei Monaten so gut wie beendet war – Napoleons Flucht traf ihn in den letzten Vereinbarungen -, wurde er auch nicht wieder aufgenommen. Der nach Waterloo verschärfte Kurs gegenüber Frankreich wurde in separaten Verhandlungen festgelegt und abgestimmt, wobei wiederum die Engländer den Rachedurst der Preußen bremsen mussten, die auf dem russischen Auge trotz Alexanders öffentlich geäußerten Erlösungs- oder besser Expansionsideen einen blinden Fleck zeigten.
Abschließend geht Zamoyski noch auf die Folgen des Wiener Kongresses ein und bestätigt die schon von Zeitgenossen geäußerte Meinung, dass er außer Geschacher um Land nichts gebracht habe. Weder wurden Ungerechtigkeiten an kleineren Ländern und Fürstenhäusern aus der Zeit Napoleons und davor bereinigt, noch wurde das politische System auf eine gesunde Basis gestellt. Den Verbündeten ging es in erster Linie um die Verbreiterung der eigenen Machtbasis und um die Eindämmung der unmittelbaren Konkurrenten, sprich: der anderen Verbündeten. Die Interessen der anderen Länder – von Norwegen über Schweden, Dänemark, die Fürstentümer des Rheinbundes über die Schweiz bis hin zu italienischen Fürstentümern und dem Vatikan – wurden entweder unter den Tisch gekehrt oder in einem unwürdigen Ringtausch bedient, der wiederum die Basis für weitere Konflikte und Kriege schuf. Das einzig Positive, das man dem Kongress zuschreiben kann, war die Tatsache, dass er für eine Weile für eine gewisse Ruhe sorgte, die aber bald mit massiver polizeilicher Überwachung sichergestellt werden musste. Zamoyski wagt den nicht ganz abwegigen Schluss, dass die rein machtorientierten Landverschiebungen und die mangelnde Beachtung sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen letztlich die Basis für die Kriege des ausgehenden 19. – 1870/71 – und des 20. Jahrhunderts schufen.
Das Buch „1815“ von Adam Zamoyski ist im Verlag C.H. Beck erschienen, umfasst 704 Seiten und kostet 29,95 Euro.
Frank Raudszus

No comments yet.