Der Wiener Philosoph bricht eine philosophische Lanze für Großartigkeit und emotionale Verausgabung.
Vor knapp fünf Jahren haben wir an dieser Stelle Robert Pfallers Kritik an der heute angeblich vor allem in der westlichen Welt vorherrschenden lustfeindlichen, asketischen Ich-Kultur in seinem Buch „Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft“ vorgestellt. Das neue Buch schließt in Thema und Tonfall nahtlos an jene Publikation an, ja besteht teilweise aus einer Wiederaufnahme damaliger Thesen. Ohne hier gleich von Selbstplagiat sprechen zu wollen, muss man doch die streckenweise Überlappung der Überlegungen konstatieren. Darüber hinaus bringt Pfaller allerdings auch eine Reihe neuer Aspekte und Themen zur Sprache, die zwar den selben Befund zum Gegenstand haben, jedoch eine leicht verschobene Perspektive eröffnen.
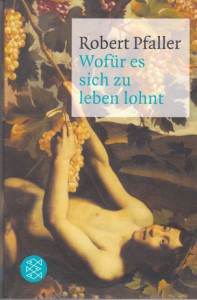 Gleich zu Beginn geht Pfaller mit den politischen und kulturellen Eliten der westlichen – sprich: kapitalistischen – Gesellschaften ins Gericht. Sie hätten jeden irrationalen Genuss als „politisch inkorrekt“ erklärt und stellten ihn unter den Generalverdacht der Lebensschädlichkeit. Wie schon in seinem oben erwähnten Buch zieht er als Beispiel wieder das Rauchverbot heran, das geradzu der Paradefall einer fanatischen Verbotskultur sei. Das gilt für ihn auch für die „asketische Linke“, die alle irrationalen und glamoureusen Aktivitäten als Verschwendung knapper Ressourcen ächte und zu unterbinden trachte. Ein Beispiel ist für ihn der Bologna-Prozess, bei dem den Universitäten die Freiheit von Forschung und Lehre und den Studierenden die Lust am Lernen genommen würden. Verantwortlich seien hierfür subalterne Linke, die sich für eigene wissenschaftliche Frustrationen mit harten Effizienzprogrammen an dem System rächten. Die Verantwortung dafür schiebt er allerdings gleich zu Beginn einer „neoliberalen“ Bewegung zu, die alle Lust am Leben zu unterbinden trachte, um davon selbst zu profitieren. Ungeachtet der Tatsache, dass er diese neoliberale Weltverschwörung nur pauschal ohne eindeutige Zuordnung beschwört und dass der Verweis auf die „frustrierten“ Linken eine gehörige Portion elitären Hochmuts enthält, tun sich hier einige Widersprüche auf. Geht man nämlich davon aus, dass mit den „Neoliberalen“ die Vertreter der freien Marktwirtschaft gemeint sind, fragt man sich, wie und warum gerade diese die Lust an Leben und Genuss unterdrücken sollten. Allein die täglich zu erleidende Werbung sagt genau das Gegenteil aus. Das streng eingeforderte Rauchverbot kann man kaum der Tabakindustrie, das latent drohende Alkoholverbot nicht den Bierbrauereien und die durchaus berechtigten Proteste gegen den irrationalen Zirkus der Formel I kaum den Autoherstellern anlasten.
Gleich zu Beginn geht Pfaller mit den politischen und kulturellen Eliten der westlichen – sprich: kapitalistischen – Gesellschaften ins Gericht. Sie hätten jeden irrationalen Genuss als „politisch inkorrekt“ erklärt und stellten ihn unter den Generalverdacht der Lebensschädlichkeit. Wie schon in seinem oben erwähnten Buch zieht er als Beispiel wieder das Rauchverbot heran, das geradzu der Paradefall einer fanatischen Verbotskultur sei. Das gilt für ihn auch für die „asketische Linke“, die alle irrationalen und glamoureusen Aktivitäten als Verschwendung knapper Ressourcen ächte und zu unterbinden trachte. Ein Beispiel ist für ihn der Bologna-Prozess, bei dem den Universitäten die Freiheit von Forschung und Lehre und den Studierenden die Lust am Lernen genommen würden. Verantwortlich seien hierfür subalterne Linke, die sich für eigene wissenschaftliche Frustrationen mit harten Effizienzprogrammen an dem System rächten. Die Verantwortung dafür schiebt er allerdings gleich zu Beginn einer „neoliberalen“ Bewegung zu, die alle Lust am Leben zu unterbinden trachte, um davon selbst zu profitieren. Ungeachtet der Tatsache, dass er diese neoliberale Weltverschwörung nur pauschal ohne eindeutige Zuordnung beschwört und dass der Verweis auf die „frustrierten“ Linken eine gehörige Portion elitären Hochmuts enthält, tun sich hier einige Widersprüche auf. Geht man nämlich davon aus, dass mit den „Neoliberalen“ die Vertreter der freien Marktwirtschaft gemeint sind, fragt man sich, wie und warum gerade diese die Lust an Leben und Genuss unterdrücken sollten. Allein die täglich zu erleidende Werbung sagt genau das Gegenteil aus. Das streng eingeforderte Rauchverbot kann man kaum der Tabakindustrie, das latent drohende Alkoholverbot nicht den Bierbrauereien und die durchaus berechtigten Proteste gegen den irrationalen Zirkus der Formel I kaum den Autoherstellern anlasten.
Doch abgesehen von dieser politischen „Vorspannung“ des Autors liefert er in diesem Buch eine Reihe bedenkenswerter und stichhaltiger Analysen. Den Grund für die Unterbindung aller genussorientierten Seiten des Lebens verortet er in einem „Hass auf das Leben“, der letztlich auf einen stetig wachsenden Narzissmus zurückzuführen sei. Dazu analysiert er die unterschiedlichen Grundhaltungen der Komödie und der Tragödie. Erstere ordnet er dem Materialismus zu, da sie letztlich stets das „Gute“ und Großartige siegen lasse, während die Tragödie stets das notwendige(!) Scheitern alles Großartigen postuliere, ja: geradezu feiere. Der Triumph des großartigen Individuums werde damit in eine andere Welt verschoben, entweder ins christliche Jenseits oder in die innere Scheinwelt des narzisstischen Individuums, das sich durch das Scheitern bestätigt fühle. In einer Art Umkehrschluss werde das Scheitern im Hier und Jetzt zum Markenzeichen des Großartigen erklärt. Anders ausgedrückt: die Schwachen seien die Guten und die Starken die Bösen. In diesem Zusammenhang geht Pfaller detailliert auf die Stoiker und die Epikureer ein. Den Stoikern wirft er in gewissem Sinne vor, das Leben dadurch retten zu wollen, dass man auf seine Vorzüge verzichtet. Letztlich sei gerade die Ich-Bezüglichkeit der stoischen Absage an die Lebenslust eine gesteigerte Variante des Narzissmus.
Zwangsläufig kommt er vom Narzissmus auf den Neid zu sprechen, den er mit dem knappen Satz “ lieber du arm als ich reich“ charakterisiert. Neid ist für Pfaller stets das Schielen auf den Anderen, sozusagen ein Altruismus mit umgekehrten Vorzeichen. Der Neidische beneide den Anderen stets um etwas, was er selbst im Grunde genommen gar nicht wolle. Als Beispiel führt er den Eifersüchtigen an, der den Nebenbuhler um die Frau beneide, die der Eifersüchtige (jetzt) hasse.
Vom Neid kommt Pfaller auf die seiner Meinung nach geradezu paranoide Fixierung der (westlichen) Gesellschaft auf Dogmen wie Umwelt und „political correctness“ zu sprechen. Dabei unterscheidet er zwischen den irrationalen Grundströmungen „Aberglaube“ und „Bekenntnis“. Ersterer lasse sich als „Objekt-Liebe“ verstehen und führe zu sofortigen Aktionen, letzteres als narzisstische „Ich-Liebe“ (ich bekenne mich zu…), die zu eine Gelassenheit führe. Die „Paranoische Einbildung“ der heutigen Gesellschaft sei eine Mischung aus Bekenntnis und Aberglaube ohne die Distanz des Wissens und führe zu einer hohen Gewissheit und damit zu dem Gefühl der Dringlichkeit.
Pfaller fordert, diese Paranoia durch eine „Verdoppelung des Erwachsenseins“ aufzuheben. Erwachsensein dürfe nicht zu einem totalitären Verweigern jeglicher „nicht-erwachsenen“ Verhaltensweisen führen, sondern man müsse auf „erwachsene Weise erwachsen werden“, knapper ausgedrückt „erwachsen erwachsen werden“. Das Adverb hat in dieser „Verdoppelung“ den Vorrang vor dem Adjektiv. Dasselbe gelte für den Zweifel und alle Bekenntnisse. Die vollständige, „reine“ Umsetzung eines Bekenntnisses führe stets in eine Art intoleranten Totalitarismus´, sprich: Fanatismus. Zu dieser Verdoppelungsforderung gehört für Pfaller auch, die Lebensrollen gut zu spielen. Es sei nicht ausnahmslos wichtig, „gute“ Rollen zu spielen, sondern die Rolle, die man im Leben spiele, „gut“, das heißt, mit einer gewissen Souveränität und Eleganz, zu spielen. Das treffe für den Verschwender genauso zu wie für den Sparsamen.
Von daher leitet er eine Analyse des Sakralen ab. Dabei unterscheidet er zwischen „Sacrum“, das Opfer und Tod bedeutet, und „Sanctum“, das den Märtyrer und das Heilige benennt. Das „Sacrum“ ist für Pfaller eng mit dem Frühling verbunden (siehe Strawinskys „Sacre du Printemps“), da es im Opfer die Verschwendung feiere wie der Frühling die Verausgabung aller seiner Ressourcen. Dagegen verweise das „Sanctum“ auf den Narzissmus, der nur das eigene Ich als lustvoll empfinde und den Anderen als das Unlustvolle begreife. Pfaller beschließt diese Überlegungen mit der Feststellung, dass unsere Gesellschaft alles Lebenswerte für ein langes Leben (bis 95) opfere, ohne sagen zu können, wozu dieses lange Leben dienen solle.
Ein eigenes Kapitel widmet Pfaller auch dem Schenken und dem Geschenk, das für ihn gemäß dem englischen Begriff „gift“ stets etwas von einem ungeliebten Gegenstand habe, den man schnell weitergeben wolle. Er belegt dies am Beispiel des Kitschobjekts, das bei Intellektuellen durchaus beliebt sei, solange man es als Geschenk deklarieren und damit ironisieren – und gegebenenfalls verschenken – könne. Das Schlimmste sei der Verdacht, man habe das Kitschobjekt aus eigenem Entschluss käuflich erworben. Auch diese Eigenart des Geschenks verweist für Pfaller wieder auf die narzisstische Struktur der Gesellschaft.
Im Zusammenhang mit der Beschreibung des „Großartigen“ und „Verschwenderischen“, die das Leben erst lebenswert machten, kommt Pfaller auf die „Überschüsse“ zu sprechen, die jede Gesellschaft erwirtschafte und entweder in Wachstum (anfangs) oder Fortpflanzung (später) investiere. Diese Überschüsse sind für Pfaller wie das Leben selbst eine Gabe, die man genießen müsse. Glamour, Eleganz, gute Sitten, Höflichkeit und Großzügigkeit seien Zeichen der Lebensfreude und machten das Leben erst lebenswert. Der heutige Effizienzwahn in allen Lebensbereichen sei ebenfalls eine Verschwendung, allerdings eine unwissentliche, da hoher Aufwand dafür getrieben werde, das Leben zwar abzusichern, ihm aber auch alle Lust zu rauben. Pfaller erwähnt in diesem Zusammenhang, dass große Lebenskünstler und Verschwender sogar das eigene Leben riskiert hätten, um Höhepunkte des Lebens zu genießen. Künstler gehören ebenso dazu wie Spieler.
Nach einigen eher marginalen Ausführungen zu Tisch- und Essmanieren mit all ihren bizarren Ausprägungen kommt Pfaller schließlich auf die Auseinandersetzung des französischen Philosophen George Bataille mit den Thesen des niederländischen Philosophen Johan Huizinga zu sprechen. Huizinga hatte das „Spiel“ als grundlegend für die menschliche Lebensführung und – einstellung betrachtet und auf den „heiligen Ernst“ der Spielenden und ihrer Zuschauer (Fußball!) verwiesen. Bataille widerspricht ihm in einigen Punkten, stimmt ihm in anderen wieder zu, und Pfaller vergleicht die Argumentationen kritisch und bewertet sie aus einer eigenen Sicht.
Wenn auch für Pfaller bisweilen seine eigene Kritik an Adornos „hastige[r] und dogmatische[r] Kritik“ selbst gilt (siehe „neoliberal“), so bleibt doch am Ende des Buches zu Recht der Satz von Juvenal stehen „Et propter vitam vivendi perdere causas“. Pfaller hat in diesem Buch die Finger auf die Wunden einer Gesellschaft gelegt, die sich zu einer selbstgerechten und inhärent totalitären Verbotskultur im Namen der „politischen Korrektheit“ jeglicher Couleur zu entwickeln droht.
Das Buch“Wofür es sich zu leben lohnt“ ist im Fischer Taschenbuchverlag unter der ISBN 978-3-596-18903-8 erschienen, umfasst 305 Seiten und kostet 9,99 €.
Frank Raudszus

No comments yet.